Mehrheits- und Verhältniswahlrecht
Der folgende Text beleuchtet die beiden grundsätzlichen Varianten des
Wahlrechts, nennt die jeweiligen Vor- und Nachteile und beschäftigt sich mit
den Folgen, die das Wahlrecht für das politische System mit sich bringt.
[Seitenanfang]

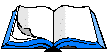 |
Wahlrecht und Demokratie
|
Einleitung
(...) Bei der praktischen Durchführung von Wahlen haben sich
zwei grundlegend verschiedene Systeme, Mehrheitswahl und Verhältniswahl,
herausgebildet. Selten werden diese jedoch rein angewandt, häufig (...) mischt
man sie. Die politische Struktur eines Landes und der Prozess der politischen
Willensbildung können entscheidend durch die Ausgestaltung des Wahlrechtes
beeinflusst werden, da sowohl die innerparteiliche Ordnung wie auch das
Verhältnis der Parteien zueinander und die Beziehungen von Regierung und
Parlament vom Wahlrecht abhängig sind. Andererseits gilt auch, dass bestimmte
politische Traditionen, historische Situationen und gesellschaftliche
Bedingungen nur bestimmte Wahlsysteme zulassen. Man kann nicht jedes Wahlsystem
in einem Land beliebig einführen. Wer am Wahlrecht manipuliert, ohne die
konkret gegebene politische und soziale Struktur zu berücksichtigen, riskiert,
dass die Wahlen ihre Hauptfunktion verlieren; wenn das Wahlrecht nicht von der
Bevölkerung akzeptiert und als gerecht anerkannt wird, wird auch die Herrschaft
derjenigen, die von der Mehrheit gewählt sind, von der Minderheit nicht mehr
als rechtmäßig anerkannt und hingenommen.
[Seitenanfang]
Verhältniswahl:
Vor- und Nachteile
Wie sehr politischer Stil und politische Struktur eines
Gemeinwesens von der Ausgestaltung des Wahlrechts beeinflusst werden, zeigt eine
kurze Betrachtung der hauptsächlichen Unterschiede. Die Verhältniswahl beruht
auf dem Prinzip, dass die Sitze im Parlament genau in dem gleichen Verhältnis
verteilt werden, wie die Stimmen der Wähler sich auf die Parteien im ganzen
Wahlgebiet verteilt haben. Erringt eine Partei zehn Prozent der Stimmen, erhält
sie auch zehn Prozent der Mandate. Das Parlament wird so zu einer politischen
Fotografie der Meinungsströmungen in der Wählerschaft. Jede Minderheit und
jede politisch-programmatische Richtung ist vertreten und kann im Parlament ihre
Stimme zu Gehör bringen. Auch erlaubt das Verhältniswahlrecht relativ leicht,
neue Parteien erfolgreich zu gründen, weil es für ihre Vertretung schon
genügt, wenn sie in allen Wahlkreisen nur einige Stimmen gewinnen, da diese
dann, im Gesamtgebiet zusammengerechnet, doch vielleicht ein Prozent ausmachen
und so der neuen Partei einige Abgeordnetensitze im Parlament verschaffen. Der
Anreiz, neue Parteien zu bilden, bringt ohne Zweifel ein belebendes Element mit
sich, begünstigt freilich auch das Entstehen von Splitterparteien und eng
begrenzten Interessengruppen. Dem Verhältniswahlrecht entspricht deshalb oft
ein in viele Fraktionen zergliedertes Parlament, aus dem labile
Koalitionsregierungen hervorgehen mit all ihren bekannten Führungsschwächen
und Krisen.
[Seitenanfang]
Der Wähler kann mit seiner Stimme die Regierungsbildung kaum
beeinflussen, weil sich die Parteien in der Regel im Wahlkampf nicht auf eine
bestimmte Koalition festlegen. Da zudem Erfolge der Regierung jeder
Koalitionspartner bei sich verbucht, Misserfolge jedoch dem Partner zuschiebt,
wird es dem Wähler schwer gemacht, im Positiven wie im Negativen die
Verantwortlichen zu erkennen. Die Parlamentskandidaten werden beim
Verhältniswahlrecht von den Landes- oder Bezirksparteitagen und nicht von den
lokalen Parteigremien aufgestellt, was im Zweifelsfall den Parteivorständen
stärkere Einwirkungsmöglichkeiten gibt. Der Wähler hat dann nicht einen
einzelnen Kandidaten zu wählen, sondern seine Stimme der Liste der einzelnen
Parteien, auf der deren Kandidaten in bestimmter Reihenfolge aufgezeichnet sind,
zu geben. Das bedeutet, dass der einzelne Wähler nicht einen bestimmten
Wahlkreisabgeordneten hat, erlaubt aber den Parteien, bei der Aufstellung der
Liste alle wesentlichen Gruppen der Partei und der angesprochenen
Wählerschichten zu berücksichtigen. Das wiederum ermöglicht den
Interessenverbänden über die Zusage, die Partei zu unterstützen, ihre Leute
auf die Kandidatenliste zu bringen.
[Seitenanfang]
Mehrheitswahl:
Vor- und Nachteile
Im Gegensatz zur Verhältniswahl wird bei Mehrheitswahl das
gesamte Wahlgebiet in so viele Wahlkreise aufgeteilt, wie Sitze im Parlament zu
vergeben sind. Als gewählt gilt, wer in den einzelnen Wahlkreisen entweder die
absolute oder die relative Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt hat. Das
gelingt in der Regel nur den Bewerbern, die sich auf große oder regional
verankerte Parteien stützen können. Diese wiederum müssen es vermeiden, bloß
einzelne Interessen zu vertreten. Sie müssen für möglichst große und viele
Gruppen der Bevölkerung attraktiv erscheinen, damit überhaupt eine Mehrheit
entstehen kann. Das Mehrheitswahlrecht zwingt darum in der Regel die Parteien,
in ihrem Programm und praktischen Verhalten sich zu mäßigen und die Extreme zu
meiden.
Historisch gesehen hängen Mehrheitswahl und
Zweiparteiensystem aufs engste zusammen. Das Mehrheitswahlrecht kann zwar ein
Zweiparteiensystem nicht erzeugen, vermag es aber zu erhalten und zu sichern.
Der Wähler entscheidet unter solchen Bedingungen in der Wahl zwischen zwei
verschiedenen Regierungsprogrammen und Regierungsmannschaften. Die
Parlamentswahl bekommt die Tendenz, zur Regierungswahl zu werden. Die siegreiche
Regierungsmannschaft kann sich dann in der Regel auf eine stabile
parlamentarische Mehrheit ihrer Partei stützen. Dem Wähler wiederum wird es
dadurch leicht gemacht, bei der nächsten Wahl die Regierung zur Verantwortung
zu ziehen, weil bei klaren Mehrheitsverhältnissen der politische Erfolg oder
Misserfolg eindeutig festgelegt werden kann und etwaige Rückschläge sich nicht
auf die Koalitionspartner abschieben lassen. Der Einfluss des Wählers auf die
Regierungsbildung und die mögliche Führungskraft einer auf die absolute
Mehrheit gestützten Regierung sind die Vorzüge eines durch das
Mehrheitswahlrecht stabilisierten Zweiparteiensystems. Außerdem schafft das
Mehrheitswahlrecht eine relativ enge Verzahnung zwischen Parlament und
Wahlkreis, verankert die Abgeordneten gewissermaßen in einem bestimmten Gebiet
und verhindert so eine allzu weite Distanz zwischen Wähler und Gewähltem.
Zugleich gewinnt bei der Kandidatenaufstellung die untere lokale
Parteiorganisation einen größeren Einfluss, was im Sinne der inneren
Demokratisierung der Parteien durchaus erwünscht ist.
[Seitenanfang]
Dennoch dürfen die Nachteile der Mehrheitswahl nicht
übersehen werden. Aufstellung der Kandidaten nur aus dem Blickwinkel lokaler
Interessen bedeutet häufig, dass bestimmte Minderheiten oder Gruppen der
Bevölkerung praktisch nicht vertreten werden. So ist es zum Beispiel für
Frauen angesichts der bestehenden Umstände auch heute noch leichter, über die
Liste einer Partei in das Parlament einzuziehen als einen Wahlkreis direkt zu
erobern.
Da außerdem in einem Wahlkreis jeweils nur die Stimmen für
den erfolgreichen Kandidaten zum Zuge kommen, bleiben erhebliche Wählergruppen
im Parlament unvertreten. Oft verschafft das Mehrheitswahlrecht einer knappen
Mehrheit der Wählerschaft eine überstarke Repräsentanz im Parlament. Es hat
in England Zeiten gegeben, in denen die Konservativen bei einem Stimmenanteil
von 38,2 Prozent im Parlament über 56 Prozent der Sitze verfügten. Zum Teil
liegt das an der Einteilung der Wahlkreise, die kaum gleich groß zu halten sind
und außerdem so geschnitten werden können, dass dadurch eine Partei
begünstigt oder benachteiligt wird. Solche "Wahlkreisgeometrie"
eröffnet ein weites Feld für Manipulationen. Überdies lässt das
Mehrheitswahlrecht Minderheiten, wenn sie nicht lokal sehr massiert, d.h. in
einigen Wahlkreisen in der Mehrheit sind, keine parlamentarische Vertretung
zukommen. Die Entstehung neuer Parteien ist praktisch unmöglich. Und auch die
Stabilität der Regierung mit absoluter Mehrheit ist dann in Frage gestellt,
wenn das Rennen der Parteien "Kopf an Kopf" beendet wurde.
[Seitenanfang]
Funktionierendes Mehrheitswahlrecht setzt darum voraus, dass
die beiden Parteien sich nach allen Seiten offen halten und nicht in
prinzipieller Opposition gegeneinander stehen. Sonst würde ein Wechsel zwischen
den Parteien zugleich eine Totalumwälzung des Gemeinwesens bedeuten. Ferner
verlangt das durch ein Mehrheitswahlrecht stabilisierte Zweiparteiensystem einen
starken Konsensus in der Bevölkerung. Das Gefühl, gemeinsam in einem Boot zu
sitzen, und die Bereitschaft, den Vertreter der gegnerischen Partei nicht als
Feind zu betrachten, sondern zu tolerieren, muss weit verbreitet sein. In einem
Volk, das sozial zerstritten und in den Grundfragen des politischen
Zusammenlebens uneinig ist, würde das Mehrheitswahlrecht deshalb nicht selten
zu negativen Effekten führen, weil ein Machtwechsel wegen der Starrheit der
Fronten nicht möglich wäre und große Minderheiten unvertreten blieben, Nicht
Mäßigung, sondern Radikalisierung und Polarisierung wäre die Folge. In einem
solchen Fall wird man eher versuchen müssen, das Verhältniswahlrecht zu
modifizieren (...).
Es fällt schwer, vom Prinzip her zu entscheiden, welches
Wahlsystem nun das eigentlich demokratische ist. Je nach den historischen
Traditionen, dem existierenden Parteiensystem und den sozialen Verhältnissen in
einer Gesellschaft wird man für dieses oder jenes System plädieren müssen.
Auch für diesen Baustein der Demokratie gibt es also kein allgemein gültiges
Rezept, sondern durchaus unterschiedliche Formen, in denen Demokratie
verwirklicht werden kann und deren Angemessenheit sich danach bemisst, ob sie
ein Maximum an politischer Beteiligung der Wähler bei gleichzeitiger
Regierungsfähigkeit der Gewählten gewährleisten.
[entnommen aus: Waldemar Besson/Gotthard Jasper, Das Leitbild
der modernen Demokratie. Bauelemente einer freiheitlichen Staatsordnung, Bonn
1990]
[Seitenanfang]