|
| |
Oberstes
Ziel der Vereinten Nationen (UN) ist der Frieden. Zu diesem Zweck wurde die
Weltorganisation als Nachfolger des Völkerbunds nach dem Zweiten Weltkrieg
gegründet. Allerdings war der Sicherheitsrat, das wichtigste Organ der UN,
während des Ost-West-Konflikts blockiert. Mit den epochalen Umbrüchen der
Jahre 1989 und 1990 schien dann doch noch verspätet eine Glanzeit für die UN
anzubrechen. Aus dieser Zeit stammt die "Agenda für den Frieden",
eine der wichtigsten Friedensstrategien der Gegenwart:
|
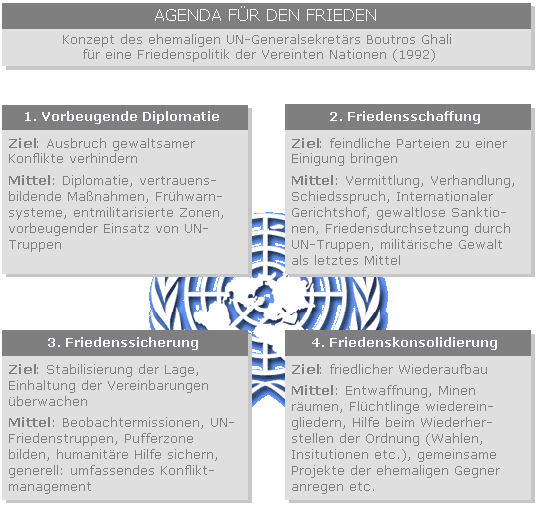
|
[Autor: Ragnar Müller]
Friedenspolitik
der Vereinten Nationen
"Die
Gründer der Vereinten Nationen standen unter dem unmittelbaren Eindruck der
Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Ihr oberstes Ziel war es daher, mit den
Vereinten Nationen ein Instrument zu schaffen, um „künftige Geschlechter vor
der Geißel des Krieges zu bewahren“ (Präambel der Charta der Vereinten
Nationen). Damit wurde die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit zur Hauptaufgabe der Vereinten Nationen erklärt.
Der Begriff „Frieden“ wird in der Charta der Vereinten Nationen in vielfältiger
Weise verwendet, ohne dass er an irgendeiner Stelle klar definiert ist. Im
System des „klassischen“ Völkerrechts wurde „Frieden“ im 19. und zu
Beginn des 20. Jahrhunderts überwiegend als bloße Abwesenheit von Krieg
verstanden. Das Friedensverständnis der Vereinten Nationen geht über diesen
engen Friedensbegriff hinaus und befürwortet eine umfassende
Friedensvorstellung im Sinne eines globalen, dynamischen Prozesses, an dessen
Ende soziale Gerechtigkeit, die Respektierung und Durchsetzung der
Menschenrechte und gutnachbarliche Beziehungen zwischen allen Ländern gewährleistet
sind. Die Charta verpflichtet alle Mitgliedstaaten daher nicht nur, auf die
Androhung oder Ausübung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele zu
verzichten, sondern fordert alle Staaten auf, ihre Konflikte mit friedlichen
Mitteln zu lösen und die Zusammenarbeit in allen Bereichen zu entwickeln.
Um den Frieden zu wahren, wurde in der VN-Charta ein modifiziertes System
kollektiver Sicherheit geschaffen, mit dem Sicherheitsrat als dessen zentralem
Organ. Nur der Sicherheitsrat hat das Recht, Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII
der Charta gegen Staaten zu verhängen, die den Weltfrieden bedrohen. Solche
Zwangsmaßnahmen reichen von nichtmilitärischen Sanktionen, z.B. Wirtschafts-
und Waffenembargo bis zum militärischen Einsatz von Land-, Luft- und
Seestreitkräften, wozu Mitgliedstaaten nach Artikel 43 der Charta den Vereinten
Nationen Streitkräfte zur Verfügung stellen können, die im Bedarfsfall unter
dem Oberkommando der Vereinten Nationen eingesetzt werden. Zwangsmaßnahmen nach
Kapitel VII der Charta waren z. B. das Handelsembargo gegen Ex-Jugoslawien und
die Einrichtung der Flugverbotszonen über Bosnien-Herzegowina. Nach Artikel 42
und 48 der Charta können Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats auch von
einzelnen Mitgliedstaaten durchgeführt werden. Das war beispielsweise der Fall
bei der Ermächtigung der Alliierten zum Einsatz von Truppen im Golfkrieg 1990
sowie bei der Autorisierung der Operation UNITAF (United Task Force) 1992 in
Somalia mit der Aufgabe, humanitäre Transporte zu sichern.
Allerdings erwies sich das System der kollektiven Sicherheit aufgrund der
Struktur des Sicherheitsrats in der Ära des Kalten Krieges weitgehend als
unwirksam. Alternativ wurde daher schon 1956 während der Suez-Krise vom
damaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammarskjöld, eine neue
Konzeption entwickelt: die der sogenannten friedenssichernden Operationen (Peace-keeping
Operations), kurz: Friedenssicherung (Peacekeeping).
Die folgende Typisierung der friedenspolitischen Konfliktbewältigungsstrategien
und -instrumente wurde in ihren Grundzügen erstmals in der Agenda für den
Frieden (1994) vom damaligen Generalsekretär Boutros-Ghali vorgenommen und später
modifiziert:
Vorbeugende Diplomatie (preventive
diplomacy), hierunter fällt der Einsatz diplomatischer Mittel mit dem Ziel, das
Entstehen von Streitigkeiten zwischen einzelnen Parteien zu verhüten, die
Eskalation bestehender Streitigkeiten zu Konflikten zu verhindern und - sofern
es doch zu Konflikten kommen sollte - diese einzugrenzen.
Vorbeugende Einsätze (preventive
deployments) sind präventive Truppeneinsätze, um den Ausbruch eines Konfliktes
im Vorfeld zu verhindern. Bei einer innerstaatlichen Krise kann ein vorbeugender
Einsatz auf Antrag bzw. mit Zustimmung der Regierung oder aller Konfliktparteien
erfolgen. Gleiches gilt, wenn ein Land sich bedroht fühlt und die Errichtung
einer VN-Truppe nur auf seiner Seite der Grenze beantragt.
Friedensschaffung (peace-making) ist
der Prozess bis zum Abschluss eines Friedensvertrags oder Waffenstillstands und
bezeichnet Aktivitäten mit dem Ziel, feindliche Parteien zu einer Einigung zu
bringen, im wesentlichen durch solche friedlichen Mittel, wie sie in Kapitel VI
der VN-Charta vorgesehen sind.
Friedenssicherung (peace-keeping)
bezeichnet die Errichtung einer personellen Präsenz der Vereinten Nationen vor
Ort mit Zustimmung aller Konfliktbeteiligten durch Einsatz von durchweg
leichtbewaffneten Soldaten, Wahlbeobachtern und Polizisten zur Überwachung und
Durchführung von Waffenstillstands- und Friedensvereinbarungen. Die
Friedenssicherung ist eine Technik, welche die Möglichkeiten für eine
Konfliktverhütung wie auch eine Friedensschaffung erweitert.
Friedensdurchsetzung (peace-enforcement)
sind Einsätze stärker bewaffneter VN-Truppen und als vorläufige Maßnahme
nach Kapitel VII, Artikel 40 der VN-Charta zu verstehen. Darunter fallen Maßnahmen
z. B. zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Waffenruhe, die aufgrund
ihrer stärkeren Bewaffnung über den Auftrag an Friedenstruppen hinausgehen,
aber nicht mit Zwangsmaßnahmen zu verwechseln sind, die - nach Artikel 43 der
Charta - verhängt werden können, um gegen Angriffshandlungen vorzugehen.
Friedenserzwingung durch militärische
Gewalt (use of military force) bezeichnet militärische Zwangsmaßnahmen
nach Kapitel VII, Artikel 42 der Charta, die bei Bedrohung oder Bruch des
Friedens oder bei Angriffshandlungen verhängt werden können, um den
Weltfrieden aufrechtzuerhalten. Der Sicherheitsrat hat bislang nur selten
Gebrauch gemacht von den stärksten der militärischen Zwangsmaßnahmen. Sonderfälle
waren der Golfkrieg II (Irak-Kuwait) wie auch die erste Intervention zur
Absicherung humanitärer Hilfe in Somalia (United Task Force - UNITAF): Der
Sicherheitsrat hatte Mitgliedstaaten (die USA u. a.) ermächtigt, in seinem
Namen Maßnahmen zu ergreifen. Auch die Bombardierung bosnisch-serbischer
Stellungen durch die NATO im Sommer 1995 folgte einem Mandat des Sicherheitsrats
mit dem Ziel, die Bürgerkriegsparteien an den Verhandlungstisch zu bringen und
erst so den Abschluss des Friedensabkommens von Dayton zu ermöglichen.
Friedenskonsolidierung (post-conflict peace-building) ist nach erfolgreicher
Beendigung eines Konfliktes auf die Wiederherstellung bzw. Förderung
staatlicher Strukturen gerichtet, die geeignet sind, den Frieden zu festigen und
zu konsolidieren, um das Wiederaufleben eines Konfliktes zu verhindern. Hierzu
gehören die Demobilisierung von (Ex-)Kombattanten, ihre Entwaffnung und
Rehabilitierung durch Wiedereingliederung in die Zivilgesellschaft; ferner der
Aufbau von Verwaltung und Justiz nach rechtsstaatlichen Prinzipien."
[aus: Auswärtiges Amt (Hrsg.): ABC der
Vereinten Nationen, Berlin 2000, S. 37-39]
[Seitenanfang]
|