|
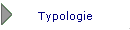
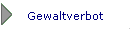
| |
Gewalt bildet in dem Krieg-Frieden-Kontinuum,
das im Rahmen dieses Grundkurses immer wieder thematisiert wird, das zentrale
Unterscheidungskriterium. Gewaltsamer Konfliktaustrag findet sich auf der
linken, gewaltfreier Konfliktaustrag auf der rechten Seite, der
"Friedenshälfte" des Kontinuums. Aber was heißt es eigentlich, wenn
man sagt, dass Konflikte gewaltsam ausgetragen werden? Handelt es sich um einen
Krieg als Form des Konfliktaustrags, dann ist die Sache relativ klar.
Schwieriger wird es in dem Abschnitt des Kontinuums zwischen dem Krieg als
Extremform auf der linken Seite und dem Wendepunkt, der Zivilisierung des
Konflikts, in der Mitte.
Gewalt ist ein Phänomen, das
weder in der Wissenschaft noch im alltäglichen Sprachgebrauch klar definiert
und abgrenzbar ist. Wenn im Fernsehen oder in der Presse von Gewalt die Rede
ist, dann handelt es sich meist um folgende Gewaltaspekte:
 |
Gewaltkriminalität (Raub- und
Morddelikte), die vor allem in Großstädten auftritt und zu 90% von
Männern ausgeübt wird; |
 |
Vandalismus: das vorsätzliche
Zerstören von Sachen; |
 |
Krawalle: gewalttätige
Ausschreitungen bei Popkonzerten, Fußballspielen oder anderen
Massenveranstaltungen; |
 |
fremdenfeindliche Gewalt:
gezielte Gewalthandlungen gegen einen ausgewählten Teil der Bevölkerung; |
 |
Gewalt zwischen Streetgangs:
gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Jugendbanden; |
 |
politisch motivierte Gewalt. |
[nach: Günther Gugel, Seminar
Gewaltprävention, Institut für Friedenspädagogik Tübingen, 2003]
Offensichtlich ist Gewalt, wenn sie als direkte physische Gewalt auftritt, wenn
also beispielsweise ein Mensch einen anderen tötet oder verletzt. Wenn nun aber
zum Beispiel die Konsumgewohnheiten der Menschen in den Industriestaaten, die
mit einem hohen Energieverbrauch einhergehen, dazu führen, dass die
Erdatmosphäre sich erwärmt, der Meeresspiegel steigt und dadurch kleine Inseln
überflutet werden, deren Bewohnern damit die Lebensgrundlage entzogen wird,
dann wird im alltäglichen Sprachgebrauch in der Regel nicht von Gewalt
gesprochen. Die Friedens- und Konfliktforschung hat deshalb versucht, einen
breiteren Gewaltbegriff zu entwickeln:
"Ende der 60er Jahre hat Johan Galtung die Unterscheidung von personaler
und struktureller Gewalt in die Diskussion eingeführt und Anfang der 90er Jahre
durch den Bereich der kulturellen Gewalt ergänzt. Bei personaler Gewalt sind
Opfer und Täter eindeutig identifizierbar und zuzuordnen. Strukturelle Gewalt
produziert ebenfalls Opfer, aber nicht Personen, sondern spezifische
organisatorische oder gesellschaftliche Strukturen, Lebensbedingungen sind
hierfür verantwortlich. Mit kultureller Gewalt werden Ideologien,
Überzeugungen, Überlieferungen, Legitimationssysteme beschrieben, mit deren
Hilfe direkte oder strukturelle Gewalt ermöglicht und gerechtfertigt,
legitimiert werden. Gewalt liegt nach Galtung dann vor, wenn Menschen so
beeinflusst werden, dass ihre tatsächliche körperliche und geistige
Verwirklichung geringer ist als ihre mögliche Verwirklichung."
[aus: Günther Gugel, Seminar
Gewaltprävention, Institut für Friedenspädagogik Tübingen, 2003]
Galtungs Begriff der strukturellen Gewalt ist der zentrale Bezugspunkt der
Diskussion um Gewalt in der Friedens- und Konfliktforschung weltweit. Er hat
viel Zustimmung dafür erfahren, dass er den Gewaltbegriff öffnet und damit
erlaubt, auch die gewaltsamen Resultate (Verhungern in der Dritten Welt)
anonymer Strukturen in den Blick zu nehmen. Er wurde aber auch scharf
kritisiert, weil er zu einem inflationären Gebrauch des Gewaltbegriffs geführt
hat: Was man nicht in Ordnung findet in der Welt, bezeichnet man als
strukturelle Gewalt und denunziert es dadurch. |
|
Als Bezeichnung
eines gesellschaftlichen Sachverhaltes mit unterschiedlichen
Handlungsinhalten muss der Begriff „Gewalt“ heute nachgerade als
Schlüsselbegriff jeglicher Erörterung der Probleme von Krieg und
Frieden gewertet werden - definieren wir doch „Krieg“ als Anwendung
organisierter militärischer Gewalt zwischen sozialen Großgruppen,
„Frieden“ in einer Minimalumschreibung als deren Abwesenheit. Die
Gewalt, von der in diesen Kontexten die Rede ist, repräsentiert
allerdings nur einen Ausschnitt aus dem breiten Inhaltsspektrum des
Gewaltbegriffs: Es handelt sich um die direkte, auf die Verletzung von
Personen oder Beschädigung von Sachen abhebende physische Gewalt. Der
gesellschaftliche Sachverhalt, den der Begriff der direkten oder
physischen Gewalt umschreibt, ist der einer eindeutig angebbaren
Subjekt-Objekt-Beziehung. Gewalt wird ausgeübt von einem Täter
(Subjekt), Gewalt wird erlitten von einem Opfer (Objekt). (...)
Im neueren (...) Sprachgebrauch hat sich der Gewaltbegriff zunehmend
auf jenen Eckpunkt des Begriffsfeldes verschoben, der durch den
Begriff (...) der (physischen) Gewaltsamkeit, gekennzeichnet ist.
Allerdings ist diese Aussage nur dann gültig, wenn wir „Gewalt“ als
einen mit der Vorstellung direkten physischen oder psychischen Zwanges
verbundenen Handlungsbegriff interpretieren, als einen Begriff, der
die Aktionen konkret identifizierbarer Personen bezeichnet.
Demgegenüber hat bereits Karl Marx in der Diskussion des
Gewaltbegriffs darauf aufmerksam gemacht, dass Gewalt auch in den
gesellschaftlichen Verhältnissen selbst begründet sein kann, dass sie
in manifester oder latenter Form innerhalb bestimmter Staats- und
Gesellschaftsordnungen alle politischen und sozialen Beziehungen
durchdringt. Gewaltverhältnisse, die solcherart nicht mehr auf
Handlungen konkreter Individuen zurückgeführt werden können. die
vielmehr die Totalität institutionalisierter Gewalt in einer
Gesellschaft umgreifen, werden identifizierbar als strukturelle
Gewalt: der Begriff der Gewalt wandelt sich in dieser Perspektive von
einem Handlungsbegriff zu einem (gesellschaftlichen) Strukturprinzip.
[aus:
Reinhard Meyers: Grundbegriffe, Strukturen und theoretische
Perspektiven der Internationalen Beziehungen, in: Bundeszentrale für
politische Bildung (Hrsg.): Grundwissen Politik, 2. Aufl., Bonn 1993,
S. 280-282] |
|
Weitere Anregungen zur Beschäftigung mit dem Begriff der Gewalt:
"The
intentional use of physical force or power, threatened or actual,
against oneself, another person, or against a group or community, that
either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death,
psychological harm, maldevelopment or deprivation."
[Gewaltdefinition der WHO (Weltgesundheitsorganisation) aus: World
report on violence and health, Genf 2002, S. 5] |
[Autor: Ragnar Müller]
[Seitenanfang]
|