|


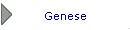
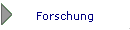
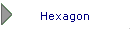
| |
|
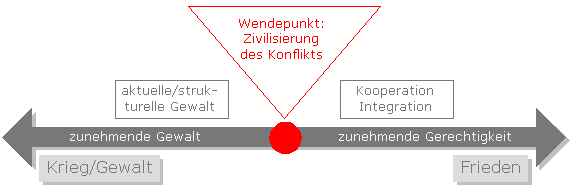
|
"Es gibt keinen Weg zum
Frieden. Frieden ist der Weg" - diese Devise von Mahatma
Gandhi weist auf ein pragmatisches Friedensverständnis hin. Konkreter wird
das folgende Zitat: "Kümmere dich um die Mittel, und die Zwecke werden
sich um sich selbst kümmern." Wichtig für Gandhi sind also die Mittel -
die Gewaltlosigkeit im Handeln -, nicht die Beschäftigung mit den Zwecken - die
Suche nach einem (utopischen) Frieden, den es in ferner Zukunft zu verwirklichen
gelte.
Auch das in diesem Grundkurs mehrfach verwendete Schaubild macht Gewalt zum
Kriterium zur Unterteilung des Kontinuums zwischen Krieg und Frieden. Frieden
beginnt, wo Gewalt aufhört und Kooperation beginnt. Verschiedene Stufen der
Kooperation und Integration markieren den Weg zum "maximalen" Frieden,
der sich nicht im Sinne eines festen Aggregatzustandes definieren lässt,
sondern eine regulative Idee oder (positive) Utopie bleibt.
Umstritten ist, wann der Frieden beginnt. Oder anders formuliert: Was
heißt es, wenn man (wie oben geschehen) sagt, dass "Gewalt aufhört"?
Mit diesen Fragen rund um die Begriffe der direkten, strukturellen und
kulturellen Gewalt befasst sich der Abschnitt
Gewalt im Rahmen dieses Grundkurses 2. Was die nähere Bestimmung des
Friedensbegriffs betrifft, so hat sich eine Unterscheidung zwischen
"positivem" und "negativem" Frieden eingebürgert. Was
darunter zu verstehen ist, diskutiert der folgende Text von Ernst-Otto Czempiel:
 |
"Der
Friede teilt das Schicksal solcher gesellschaftlicher Probleme, die nicht
verdrängt oder vergessen, sondern durch die allgemeine Aufmerksamkeit
verstellt werden. Von ihm wird ständig gesprochen: in der Politik, in den
Medien, in der Öffentlichkeit, in der Friedensbewegung. Er wird
beschworen und reklamiert. So entsteht der Eindruck, als sei er ein
bekannter, durchaus herstellbarer Zustand. Ein Abrüstungsvertrag, ein
politisches Gespräch bringen ihn näher, Aufrüstung und
Klimaverschlechterung rücken ihn in die Ferne. (...)
Friede besteht in einem internationalen System dann, wenn die in ihm
ablaufenden Konflikte kontinuierlich ohne die Anwendung organisierter
militärischer Gewalt gelöst oder zumindest behandelt werden. |
In
gewisser Weise steht diese Bestimmung dem „negativen“ Friedensbegriff nahe,
der den Frieden als Nicht-Krieg definiert. Sie gibt sich auch damit zufrieden,
dass kein Krieg herrscht. Damit ist allerdings nicht nur die Absenz des Krieges
gemeint, sondern sein Ersatz durch andere, nicht-gewaltsame Austragsmodi. Aus
dieser logischen Forderung ergibt sich, dass der „negative“ Friedensbegriff,
hätte er sich selbst je ernst genommen, viele Konsequenzen verlangt, die eine
rein nominalistisch verfahrende Diskussion erst dem „positiven“ Frieden
zugerechnet hat. Den Krieg auf Dauer zu vermeiden, heißt, ihn auf Dauer durch
nicht-kriegerische Konfliktlösungsformen zu ersetzen. Ist dies gelungen,
herrscht Friede.
Diese Bestimmung diskriminiert nicht jede Form der Gewalt, sondern nur die
organisierte militärische Beschädigung der physischen Existenz des Menschen.
Diese Bestimmung hatte sich nie - und hat sich auch jetzt nicht - auf das
„Ziel der gewaltfreien Weltgesellschaft oder, theologisch gesprochen, der erlösten
Menschen“ gerichtet (...). Sie bestimmt nur etwas deutlicher, was unter dem
allgemein anerkannten Bestandteil des Friedens, nämlich dem Nicht-Krieg,
eigentlich zu verstehen ist. Was heißt Nicht-Krieg anderes als die permanente
Absenz organisierter militärischer Gewaltanwendung? Sie ist nicht identisch mit
der zeitweisen Vermeidung des Krieges, sondern schließt seine Vorbereitung, die
Bereitschaft zum Krieg aus. Das hatte auch schon Hobbes gemeint (...), der als
Frieden eine Zeit bezeichnete, in der es weder Krieg noch die Bereitschaft dazu
gibt. Die politischen Folgen dieser konsequenten Bestimmung des Nicht-Kriegs
sind daher beträchtlich. (...)
Friede bezeichnet also das Prozessmuster eines internationalen Systems, das
charakterisiert ist durch den nicht-gewaltsamen Austrag der in ihm ablaufenden
Konflikte. Der Begriff könnte sich auch schon mit der Tendenz zufrieden geben:
Friede besteht, wenn die Konflikte in einem internationalen System tendenziell
frei von militärischer Gewalt geregelt werden. (...)
Was im „negativen“ und „positiven“ Friedensbegriff als Alternativen
gegenübergestellt wurde, erweist sich bei näherem Hinsehen als Stufenfolge.
Sie beginnt, als conditio sine qua non, mit der Beseitigung organisierter militärischer
Gewaltanwendung. Sie setzt sich fort als ein Prozess weiter abnehmender Gewalt
und weiter zunehmender Verteilungsgerechtigkeit."
[aus:
Ernst-Otto Czempiel: Friedensstrategien, Systemwandel durch Internationale
Organisationen, Demokratisierung und Wirtschaft, Paderborn 1986, S. 11, 35-37,
51]
Ernst-Otto Czempiel erachtet es ebenfalls als sinnvoll, nicht von Krieg und
Frieden als bestimmten Zuständen zu sprechen, sondern von einem Kontinuum, das
sich - wie die folgende grafische Veranschaulichung zeigt - etwas vom obigen
Kontinuum unterschiedet:
|
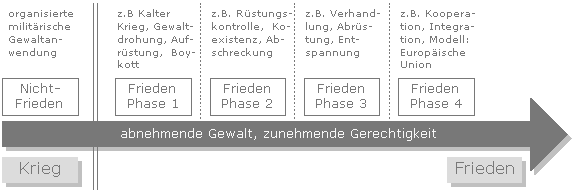 |
Den
Ausgangspunkt bildet der sogenannte "negative Friedensbegriff":
Frieden ist die Abwesenheit von Krieg, und Krieg lässt sich relativ exakt als
"organisierte militärische Gewaltanwendung" definieren. Entscheidend
ist dann aber die Unterscheidung mehrerer (aufeinanderfolgender) Phasen und
Grade des Friedens, wobei bereits Aggregatzustände wie der Kalte Krieg zum
Bereich des Friedens zählen, wenn auch zur Friedensphase mit dem geringsten
Grad an Frieden.
Ein weiterer Unterschied zum anderen Kontinuum besteht darin, dass mit der
"zunehmenden Gerechtigkeit" neben dem Maß an Gewalt(losigkeit) ein
weiteres Kriterium hinzukommt, um verschiedene Phasen des Friedens unterscheiden
zu können. Das verweist auf den engen Zusammenhang von Frieden und
Gerechtigkeit.
Weitere Anregungen zur Beschäftigung
mit dem Begriff des Friedens:
|
Es
gab nie einen guten Krieg oder einen schlechten Frieden – Benjamin
Franklin |
[Autor: Ragnar Müller]
[Seitenanfang]
|