|
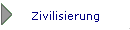
| |
|
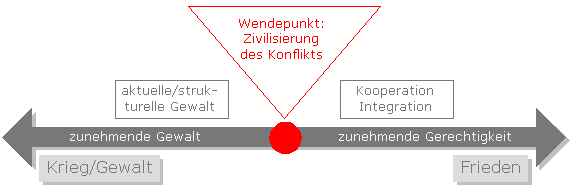
|
Das
mehrfach in diesem Grundkurs zum wissenschaftlichen Hintergrund der
Friedenspädagogik auftauchende Schaubild versucht, die zentralen Begriffe Krieg
und Frieden, Gewalt und Konflikt zueinander in Beziehung zu setzen. Das
Kontinuum zwischen Krieg und Frieden enthält alle
"Aggregatzustände", die in der internationalen Politik herrschen
können. Dabei markiert der Krieg einen Extremfall, gekennzeichnet durch sehr
hohe Gewaltsamkeit. Frieden bildet den anderen Extremfall, gekennzeichnet durch
(völlig) gewaltlose Konfliktlösung. Dazwischen lassen sich viele weitere
Aggregatzustände unterscheiden, je nach dem Maß an Gewalt, das beobachtet
werden kann.
Nun ist es von zentraler Bedeutung zu sehen, dass es Konflikte immer
gibt, im Krieg sowieso, aber eben auch im Frieden. Konflikte sind ein
Grundtatbestand des gesellschaftlichen Lebens und als solche kein Problem. Sie
bilden gewissermaßen den unsichtbaren Hintergrund für das dargestellte
Kontinuum. Es geht deshalb bei der Friedenspolitik und natürlich auch bei der
Friedenspädagogik nicht darum, Konflikte zu verhindern. Das wäre ein
sinnloses Unterfangen. Vielmehr geht es darum zu erreichen, dass Konflikte
gewaltfrei bearbeitet werden. Es geht mit anderen Worten um die Zivilisierung
des Konflikts, den Wendepunkt im Schaubild.
Der folgende Text beschäftigt sich mit dem zentralen Begriff "Konflikt"
aus wissenschaftlicher Sicht:
"Unter Konflikt im engeren, „objektivistischen“
Sinne, versteht man in der Friedens- und Konfliktforschung (...) eine unvereinbare Positionsdifferenz in einer bestimmten oder über eine
bestimmte Sache, den Konfliktgegenstand. Dies
kann ein realer Gegenstand sein, etwa der sprichwörtliche Zankapfel, den zwei
Kinder jedes für sich haben wollen. Es kann aber auch eine abstrakte
Streitfrage sein - etwa die, wie Abtreibung gesetzlich geregelt werden soll.
Konflikte in diesem Sinne sind unabdingbar mit sozialem Leben verbunden und
insofern etwas „Natürliches“, an sich weder Positives noch Negatives.
Soziale Konflikte werden manifest (offenbar)
durch das Konfliktverhalten mindestens
einer der am Konflikt beteiligten Parteien. Aus dem Konfliktverhalten aller
beteiligten Parteien resultiert insgesamt der Konfliktaustrag, bei dem vor allem zwischen friedlichen und
gewaltsamen Formen zu unterscheiden ist. Das Verhalten markiert die zweite Ecke
des begrifflichen Dreiecks, das der Friedens- und Konfliktforscher Johan Galtung
(1978) zur Konzeptualisierung von „Konflikt“ vorgeschlagen hat (...).
|
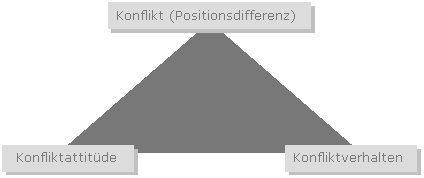 |
Die
dritte „Ecke“ stellt die „Attitüde“
dar, also die Einstellung der Akteure zum
Konfliktgegenstand, zu den anderen Akteuren und zu ihrem Konfliktverhalten.
Beispiele für eine emotionale Einstellung zum Konfliktgegenstand liefern
innenpolitisch der Streit um die Abtreibungsfrage, in der internationalen
Politik etwa der Streit um Jerusalem, das für alle beteiligten Konfliktparteien
zugleich hohen symbolischen Wert hat. Beispiel für die konfliktverschärfende
Wirkung der Attitüde gegenüber den anderen Konfliktparteien und ihrem
Verhalten ist etwa, dass bei gewaltsam ausgetragenen Konflikten der Gegner als
Un- oder gar Untermensch gesehen wird und seine Taten als barbarisch gelten,
obwohl sie sich möglicherweise von den eigenen objektiv nicht unterscheiden."
[aus:
Martin List u.a.: Internationale Politik. Probleme und Grundbegriffe, Opladen
1995, S. 111]
Ein weiterer Text widmet sich der Thematik
"Zivilisierung des Konflikt"
...
[Autor: Ragnar Müller]
[Seitenanfang]
|