|
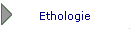
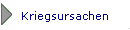
| |
Eine typische Definition
von Krieg, wie sie in der Politikwissenschaft verwendet wird, lautet
folgendermaßen:
"Bei Krieg handelt es sich um
einen bewaffneten Massenkonflikt, der folgende Merkmale aufweist:
 |
Zwei
oder mehr bewaffnete Streitkräfte sind an den Kämpfen beteiligt,
wobei es sich mindestens in einem Fall um eine reguläre Armee oder
andere Regierungstruppen handelt. |
 |
Das
Vorgehen beider Teilnehmer entfaltet sich in zentral gelenkter,
organisierter Form, auch wenn dies nicht mehr bedeutet als
organisierte bewaffnete Verteidigung oder planmäßige Überfälle
(Guerillaoperationen, Partisanenkrieg). |
 |
Die
bewaffnete Auseinandersetzung besteht nicht aus spontanen,
sporadischen Zusammenstößen. Beide Parteien gehen systematisch
vor." |
[aus:
Istvan Kende, Kriege nach 1945. Eine empirische Untersuchung,
Frankfurt/Main 1982]
|
Die Auflistung mehrerer
Bedingungen in dieser Definition, die gegeben sein müssen, damit man von einem
Krieg sprechen kann, weist schon darauf hin, dass die Abgrenzung des Krieges von
anderen bewaffneten Konflikten schwierig ist. Legt man dieses Verständnis von
Kriegen zugrunde, fällt die Bilanz hinsichtlich der Kriege seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs ernüchternd aus:
Einige Zahlen zu den Kriegen seit
1945:
 |
Die
Welt war seit 1945 lediglich 26 Tage ohne Krieg. |
 |
Die
Häufigkeit der Kriege nimmt beständig zu: 1945: 3 Kriege, 1955: 15
Kriege, 1975: 21 Kriege, 1985: 33 Kriege, 1995: 43 Kriege. |
 |
Die
Kriegsdauer nimmt zu: 41 Kriege erstreckten sich über mehr als 10
Jahre, 26 Kriege über mehr als 5 Jahre. |
 |
Die
Anzahl an Toten und das Maß an Zerstörung nimmt zu. Außerdem sind
zunehmend Zivilisten Opfer der Kriege: Der Anteil der
Zivilbevölkerung an den Kriegsopfern stieg von etwa 50% bis Ende der
70er Jahre auf 75% in den 80er Jahren und fast 90% in den 90er Jahren.
Insgesamt haben die Kriege seit 1945 zwischen 25 und 35 Millionen Tote
gefordert. |
 |
Zwischen
1945 und 1992 wurden 124 Kriege beendet, davon 28 durch einen Sieg und
36 durch eine Niederlage des Angreifers, 7 durch Abbruch der Kämpfe,
16 durch Einigung der Kriegsparteien ohne Vermittler, 37 durch
Vermittlung Dritter. |
[Zahlen
aus: Istvan Kende, Kriege nach 1945. Eine empirische Untersuchung,
Frankfurt/Main 1982]
|
Diese Zahlen deuten auch an, dass
das Zeitalter der "klassischen", d.h. der zwischenstaatlichen, Kriege
vorbei ist. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der Terroranschläge in New York
und Washington am 11. September 2001 ist eine Diskussion über den Begriff des
Krieges und über die Anpassung des Völkerrechts an diese neue Situation in
Gang gekommen. Vielfach wird von "neuen Kriegen" gesprochen:
"Die 'neuen' Kriege, in denen
Warlords und Terrorbanden agieren, sind so neu nicht. 'Privatisierte'
kriegerische Gewalt gab es vor der Epoche der Staatlichkeit schon einmal
in großem Maßstab. (...) Von den nach 1945 weltweit geführten Kriegen
waren allenfalls ein Drittel zwischenstaatliche Kriege im herkömmlichen
Sinn. Bei den restlichen zwei Dritteln handelt es sich um
innergesellschaftliche und transnationale Kriege, in denen lokale Milizen,
international rekrutierte Guerillagruppen, weltweit agierende
Terrornetzwerke sowie regionale Warlords gegeneinander Krieg führten.
Davon, dass die Staaten die legitimen wie faktischen Monopolisten des
Krieges sind, wie dies in Europa von der Mitte des 17. bis ins 20.
Jahrhundert der Fall war, kann keine Rede mehr sein. Der Krieg hat sich
seiner Fesselungen an die Staatlichkeit, die ihm völkerrechtlich mit dem
Westfälischen Frieden angelegt worden sind, entledigt, er hat sich
entstaatlicht, um nicht zu sagen privatisiert. Der einstige
Kriegsmonopolist Staat konkurriert mit parastaatlichen und privaten
Akteuren, mit Warlords, Söldnern und netzförmig miteinander verbundenen
Terrorgruppen, die untereinander, aber auch gegen Staaten Kriege
führen."
[aus:
Herfried Münkler, Das Ende des "klassischen" Krieges. Warlords,
Terrornetzwerke und die Zukunft kriegerischer Gewalt; in: Neue Zürcher
Zeitung vom 14.09.2002, S. 73]
|
Weitere Anregungen zur
Beschäftigung mit dem Begriff des Krieges:
 |
Ethologie: Was sagen
Verhaltensforscher zum Krieg?
|
 |
Kriegsursachen: Die
Erforschung von Kriegsursachen zählt zu den zentralen Arbeitsgebieten der
Friedens- und Konfliktforschung
|
|
Kaum
ein Friede ist so ungerecht, als dass er nicht dem scheinbar
gerechtesten Krieg vorzuziehen wäre – Erasmus von Rotterdam |
[Autor: Ragnar Müller]
[Seitenanfang]
|