|
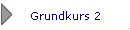
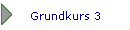
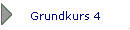
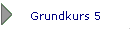
| |
"Können wir uns darauf
verlassen, dass eine Wende von ausreichend vielen Menschen ausreichend schnell
gelingt, um die moderne Welt zu retten? Diese Frage wird oft gestellt, doch wie
auch immer die Antwort ausfällt, sie wird irreführend sein. 'Ja' als Antwort
würde zu Selbstgefälligkeit führen, 'Nein' als Antwort zur Verzweiflung. Es ist
erstrebenswert, diese Verwirrungen hinter sich zu lassen und sich an die Arbeit
zu machen."
[Fritz Schumacher, Öko-Philosoph und Vorreiter der Ökologiebewegung, Autor des
1975 erschienenen Buchs "Small is Beautiful"]
Überblick über die Grundkurs-Sequenzen
Grundkurs 1: Was heißt Nachhaltigkeit?
Grundkurs 2:
Wie handle ich nachhaltig?
Grundkurs 3:
Wie funktioniert eine Lokale Agenda 21?
Grundkurs 4:
Wie kann man das Klima schützen?
Grundkurs 5:
Welche Probleme gibt es auf dem Weg zur nachhaltigen
Entwicklung?

Grundkurs 1: Was heißt Nachhaltigkeit?
Raumschiff
Erde
"Stellen wir uns die Erde als ein riesiges Raumschiff vor. Mit Menschen an
Bord rast es durch das Weltall. Die Verbindungen zum Heimatplaneten sind
abgebrochen. Es gibt keine Rückkehr mehr. Die Passagiere müssen mit den
vorhandenen Vorräten an Nahrung, Wasser, Sauerstoff und Energie auskommen.
Während die Zahl der Menschen an Bord steigt, verringern sich die Vorräte.
Gleichzeitig steigen Abfall- und Schadstoffmengen an. Das Leben wird immer
schwieriger, die Luft zum Atmen immer knapper.
Einige Bewohner des Raumschiffes geraten in Panik. Sie prophezeien einen
baldigen Tod durch Ersticken, Verdursten, Verhungern oder Erfrieren. Andere
beuten die zu Ende gehenden Vorräte aus, schlagen Warnungen in den Wind,
maßvoller damit umzugehen. Sie vertrauen darauf, dass jemandem noch in
letzter Minute etwas zur gemeinsamen Rettung einfallen werde."
[aus: Hans-Georg Herrnleben/Jochen Henrich, Thema im Unterricht 7/1997:
Umweltfragen, Bundeszentrale für politische Bildung Bonn] |
|
"Um den ... Text
vom 'Raumschiff Erde' zu lesen, haben Sie etwa eine Minute gebraucht.
(...) In einer Minute ...
 |
... beträgt der
Kohlendioxid-Ausstoss über 38.000 Tonnen. |
 |
... zerstören
die Menschen 3,5 Quadratkilometer Wald. |
 |
... produzieren
wir alle über 15.000 Tonnen Müll. |
 |
... belasten
zusätzlich über 90 neue Autos unsere Umwelt. |
 |
... werden rund
60.000 Tonnen Erde abgeschwemmt oder abgetragen. |
 |
... nimmt die
Erdbevölkerung um 165 Menschen zu. |
 |
... geht fast
ein Quadratkilometer Naturfläche durch Bebauung oder Versiegelung
verloren. |
 |
... sterben ca.
40 Menschen an Hunger." |
[aus: Hans-Georg
Herrnleben/Jochen Henrich, Thema im Unterricht 7/1997: Umweltfragen,
Bundeszentrale für politische Bildung Bonn] |
|
Der Leitbegriff "nachhaltige
Entwicklung" (sustainable development)
Nimmt man Nachhaltigkeit ernst, resultieren daraus drastische
Änderungserfordernisse in praktisch allen Lebensbereichen. Nicht nur
Konsumgewohnheiten müssen geändert werden, was sicherlich schwer genug ist,
sondern es geht darüber hinaus um einen grundlegenden Bewusstseinswandel, der
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik nachdrücklich verändern wird, wie der
folgende Text skizziert:
"Seit der
Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de
Janeiro im Sommer 1992 ist der Begriff „Sustainable Development“ ...
weltweit zu einem umweltpolitischen Leitbegriff geworden. (…) Darin kann für
die Umweltpolitik durchaus ein Hoffnungszeichen gesehen werden, denn die
integrierende Betrachtung ökologischer, ökonomischer und sozialer Probleme
macht den übergreifenden Zusammenhang deutlich, in den die Umweltprobleme
gestellt werden müssen, wenn sie sachgemäß und sozial akzeptabel gelöst
werden sollen. (…) Notwendig werden gravierende Veränderungsanforderungen an
den ökonomischen, den sozialen und politischen Bereich.
Im ökonomischen Bereich müssen neue Formen des Wirtschaftens
eingeführt werden, die den Faktor Natur als weiteren Produktionsfaktor zum
Beispiel auch bei der Preiskalkulation berücksichtigen. Dabei stellt sich
nicht nur die Frage, wie dies im Einzelfall gewährleistet werden kann -
durch politisch-administrative Steuerung und/oder Selbstverpflichtungen der
Wirtschaft -, sondern es wird auch darüber gestritten werden, wie groß die
Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft in einem dezentral operierenden Weltmarkt
ist, wenn die Schritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung nicht
international aufeinander abgestimmt werden und wohl auch nicht abgestimmt
werden können.
Im sozialen Bereich stellen sich völlig neue Anforderungen an das
Prinzip und die Praxis der Verteilungsgerechtigkeit - und zwar in dreifacher
Hinsicht: Angesichts der Tatsache, dass das Leitbild der nachhaltigen
Entwicklung aus der entwicklungspolitischen Diskussion stammt, ist erstens
die Verteilung von Entwicklungschancen im Rahmen der Nord-Süd-Problematik
betroffen. Zweitens geht es um die innergesellschaftliche
Sozialverträglichkeit einer ökologischen Modernisierung, die nicht nur mit
neuen Chancen, sondern auch mit vielen neuen Belastungen daherkommen wird.
Wie kann gewährleistet werden, dass dann Lebens-, Arbeits- und auch
Konsummöglichkeiten einigermaßen gerecht verteilt sein werden?
Die beiden bisher genannten Problemfelder werden drittens noch erweitert
durch das, was "intergenerative Verteilungsgerechtigkeit" genannt wird. Die
Interessen künftiger Generationen müssen bei der heute stattfindenden
Chancenverteilung mitbedacht werden, d.h., unsere Gesellschaft muss sich an
der Tatsache orientieren, dass unsere Gegenwart unwiderruflich die
Vergangenheit der Zukunft ist, über deren Chancen daher heute mitentschieden
wird.
Die alles entscheidende Frage betrifft die Bereitschaft der Gesellschaft,
der Wirtschaft und jedes einzelnen, diese erheblichen Anforderungen an ihr
Verhalten, an Produktions-, Konsum- und letztlich Lebensstile anzunehmen und
sich darauf auch konkret einzulassen. Das bedeutet, dass die gravierendsten
Veränderungsanforderungen sich im politischen Bereich stellen:
Schon die Formulierung der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung droht das
bestehende politische System, das auf kurzfristigen Wahlerfolg programmiert
und an permanenter Wohlstandsmehrung aus Gründen der Machterhaltung
orientiert ist, grundsätzlich zu überfordern. Erst recht bei der Umsetzung
solcher Ziele zeigt sich ein erheblicher politischer Veränderungsbedarf,
denn neue Wertorientierungen und entsprechende Lebensstile lassen sich weder
politisch beschließen noch administrativ verordnen, sie können nur
kommunikativ vermittelt werden. In der Diskussion über die Umsetzung des
Leitbildes "nachhaltige Entwicklung" herrscht daher Einigkeit darüber, dass
eine verbesserte Bürgerbeteiligung ... eine notwendige Voraussetzung für den
Erfolg dieser Idee darstellt. (...)
Das heißt, sowohl für die Zielformulierung wie auch für die verbindliche
Umsetzung der Ziele bedarf es einer völlig neuen "Dialogkultur". Sie setzt
die Bereitschaft der Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft voraus,
die Definition der Ziele wie der Umsetzungsschritte in einem offenen Prozess
mit engagierten Einzelnen, Gruppen und Verbänden gemeinsam zu erarbeiten.
(...)
Eine Politik der Nachhaltigkeit verlangt von jedem einzelnen, Verantwortung
über den Tag und über sich selbst hinaus wahrzunehmen, was dann gelingen
kann, wenn er zu erkennen vermag, dass die eigenen Interessen unauflöslich
eingebunden sind in die Interessen des Gemeinwesens. Daher zwingt die Idee
der Nachhaltigkeit zu einem qualitativen Sprung in der Bürgerbeteiligung und
letztlich in der Modernisierung der Demokratie.
Es geht nicht mehr nur um Partizipation an politisch oder administrativ
initiierten Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen, sondern um die
selbstbewusste und mitverantwortliche Teilnahme an der "Beratung über
gemeinsame Angelegenheiten" (Aristoteles), an der Gestaltungsaufgabe der
Politik.
Das bedeutet, dass zivilgesellschaftliche Akteure eine besondere
Verantwortung für die politische Durchsetzung einer Politik der
Nachhaltigkeit übernehmen müssen, was wiederum strukturelle, institutionelle
und finanzielle Konsequenzen nach sich zieht."
[aus: Horst Zilleßen, Von der Umweltpolitik zur Politik der Nachhaltigkeit.
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung als Modernisierungsansatz; in: Aus
Politik und Zeitgeschichte 50/1998, S. 3-5 u. 8] |
|
Nachhaltigkeit
ist einfach und kompliziert zugleich. Zum einen verstehen wir intuitiv,
wovon die Rede ist: "Man darf die Kuh nicht schlachten, von der man
morgen wieder Milch haben will," sagt der Volksmund. Zum anderen fällt
es uns aber schwer, uns eine wirklich nachhaltige Gesellschaft
vorzustellen. Praktisch alles müsste sich ändern, nicht zuletzt wir
selbst.
"Viel hängt davon ab, ob es gelingt, den Begriff zu schärfen und die
Idee zu entfalten, also ihr ganzes Spektrum und ihr volles Potential
ins Spiel zu bringen. Nachhaltigkeit ist weit mehr als ein
technokratischer Reißbrettentwurf zur intelligenteren Steuerung des
Ressourcen-Managements, mehr als ein Begriff aus der Retorte von Club
of Rome, Weltbank und UNO. Schubkraft bekommt die Idee, sobald sie als
ein neuer zivilisatorischer Entwurf wahrgenommen wird, als ein
neuer Entwurf, der allerdings in unseren Traditionen und in der
menschlichen Psyche verwurzelt ist. Tradition und Innovation müssen
keine Gegensätze sein. Ein gemeinsamer Vorrat an Werten, Ideen und
Träumen ist eine wichtige kulturelle Ressource."
[aus: Ulrich Grober, Die Idee der Nachhaltigkeit als zivilisatorischer
Entwurf; in: Aus Politik und Zeitgeschichte 24/2001, S. 3,
Online-Version] |
|
Die am häufigsten
gebrauchte Definition von "nachhaltiger Entwicklung" stammt von
Lester Brown, dem Gründer des
Worldwatch Institute. Sie wurde in dem
Bericht "Our Common Future" der Brundtland-Kommission aufgegriffen:
"Sustainable development is development that meets the needs of the
present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs."
[World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common
Future, Oxford 1987, p. 43] |
|
Diese Definition
von "nachhaltiger Entwicklung" wird zwar allgemein akzeptiert, aber
sie sagt nicht viel aus. Der berühmte Wissenschaftler Fritjof Capra
schlägt deshalb folgende Operationalisierung vor:
"Der Schlüssel zu einer funktionsfähigen Definition von
ökologischer Nachhaltigkeit ist die Einsicht, dass wir nachhaltige
menschliche Gemeinschaften nicht von Grund auf erfinden müssen,
sondern sie nach dem Vorbild der Ökosysteme der Natur nachbilden
können, die ja nachhaltige Gemeinschaften von Pflanzen, Tieren und
Mikroorganismen sind.
Wie wir gesehen haben, ist die herausragendste Eigenschaft des
Erdhaushalts seine immanente Fähigkeit, Leben zu erhalten. Daher ist
eine nachhaltige menschliche Gemeinschaft so beschaffen, dass ihre
Lebensweisen ebenso wie ihre unternehmerischen, wirtschaftlichen und
physikalischen Strukturen und Technologien die immanente Fähigkeit
der Natur, Leben zu erhalten, nicht stören.
Nachhaltige Gemeinschaften entwickeln ihre Lebensmuster im Laufe der
Zeit in ständiger Interaktion mit anderen menschlichen und
nichtmenschlichen lebenden Systemen. Nachhaltigkeit bedeutet somit
nicht, dass die Dinge sich nicht verändern. Sie ist kein statischer
Zustand, sondern ein dynamischer Prozess der Koevolution."
[aus: Fritjof Capra, Verborgene
Zusammenhänge. Vernetzt denken und handeln - in Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft, Bern u.a. 2002, S. 298] |
|
"Die Debatte um
nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung zielt ab auf einen
gesellschaftlichen Konsens über neue Entwicklungsziele jenseits des
auf industrielles Wachstum, Naturvergessenheit und technologische
Machbarkeitsphantasien gestützten westlichen Zivilisationsmodells, in
dieser Perspektive geht es um die Entwicklung eines innovativen,
zukunftstauglichen Leitbilds gesellschaftlicher Entwicklung im Sinne
einer regulativen Idee, wie z.B. auch Demokratie, Freiheit,
Gerechtigkeit u.ä."
[aus: Thomas Jäger/Michael Schwarz, Das sozial-ökologische
Innovationspotential einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung
auf betrieblicher und kommunaler Ebene; in: Aus Politik und
Zeitgeschichte 50/1998, Bonn, S. 23] |
|
"Bildung für
nachhaltige Entwicklung" stellt "nicht bloß eine Erweiterung der
Umweltbildung um soziale oder ökonomische Aspekte dar ..., sondern [sollte]
ein starkes Bindeglied zwischen politischer Bildung, globalem Lernen,
Umweltbildung oder Gesundheitserziehung sein."
[Willi Linder, Hohe Ansprüche; in: umwelt & bildung 3/2004, S. 3]
"Ziel der ... UN-Dekade ... ist es, die vielen Initiativen von der
politischen Bildung bis zur Umweltbildung, vom globalen Lernen bis zur
Friedenserziehung in einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
zusammenzuführen."
[Johannes Tschapka; zitiert nach: ökolog Netzwerkzeitung 3/2004 "Nachhaltigkeit
leben (und) lernen"; in: umwelt & bildung 3/2004] |
|
[Autor: Ragnar Müller]
[Seitenanfang]
|