|
| |
 |
Grundkurs 3: Wie funktioniert eine
Lokale Agenda 21?
Auf der Rio-Konferenz, der
Weltkonferenz über Umwelt und Entwicklung (1992), wurde die Agenda 21 ins
Leben gerufen. Sie ist ein globales Aktionsprogramm für nachhaltige
Entwicklung, bei dem alle Ebenen beteiligt und miteinander verzahnt sind:
Von der "Globalen Agenda 21" bis zu den unzähligen Projekten überall auf der
Welt im Rahmen der "Lokalen Agenda 21".
In diesem Abschnitt wird das Aktionsprogramm in seinen Grundzügen
vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, wie eine Lokale
Agenda 21 aussieht und was für eine erfolgreiche Initiative zu
berücksichtigen ist.
|
Global denken - lokal handeln
"Nicht viele Papiere werden so berühmt. Der Agenda 21 ... ist gelungen, was
sich manch anderes Dokument wünschen würde. Statt in die Ablage wanderte sie
durch viele Hände, erreichte zahlreiche Köpfe und prägte vielerorts das
Handeln.
Mit ihr ist auch ein Aufruf an alle Städte und Gemeinden weltweit gegangen,
einen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern anzustoßen und gemeinsam
geeignete Strategien für eine zukunftsbeständige Entwicklung zu entwerfen.
Die leitende Idee dahinter: Nachhaltige Entwicklung muss dort stattfinden,
wo Menschen leben, wo sie einkaufen, wo Arbeitsplätze geschaffen, Schulen
errichtet und Baugebiete geplant werden; in den Städten und Gemeinden also.
Und somit waren Vision und Auftrag einer Lokalen Agenda 21 geboren."
[aus: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hg.),
Lokale Agenda 21 und nachhaltige Entwicklung in deutschen Kommunen. 10 Jahre
nach Rio: Bilanz und Perspektiven, Berlin 2002, S. 24]
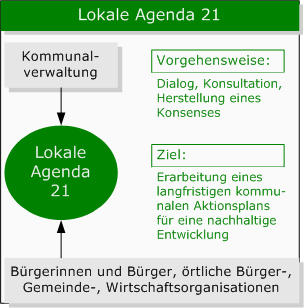
Der Weg ist das Ziel
Es gibt keinen idealen Lokale-Agenda-21-Prozess im Sinne eines fertigen
Konzepts, das man nur anzuwenden bräuchte. Jede Stadt, jede Gemeinde ist
anders und muss in einem breiten Diskussionsprozess ihren eigenen Weg finden.
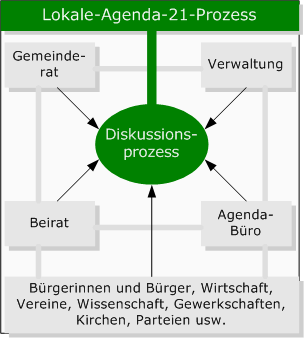
Trotzdem lassen sich einige grundlegende Elemente und Vorgehensweisen
aufzeigen. Als typische Eigenschaften eines (idealen)
Lokale-Agenda-21-Prozesses können folgende gelten:
 | Beteiligung der Kommunalverwaltung; |
 | Beteiligung der Bevölkerung,
insbesondere von Frauen und Jugendlichen, von NGO und der Wirtschaft; |
 | langfristiger Planungs- und
Diskussionsprozess, der einen integrativen Ansatz verfolgt, d.h.
ökologische, ökonomische und soziale Aspekte umfasst; |
 | Ziel ist ein Handlungsprogramm, dem alle
Beteiligten zustimmen (Konsens) und das am Leitbild der nachhaltigen
Entwicklung orientiert ist; |
 | es handelt sich um einen wechselseitigen
Lernprozess für alle Beteiligten; |
 | ein neues Politikverständnis (Kooperation
und Konsens) kommt zum Ausdruck; |
 | die Zielerreichung muss fortlaufend
anhand von möglichst klaren Indikatoren überprüft werden. |
Ein solcher Prozess bedeutet nicht einfach
die Fortführung kommunaler Umweltpolitik mit anderen Mitteln. Im Erfolgsfall
geht er weit darüber hinaus, wie der folgende Textauszug andeutet:
"Die Hauptunterschiede liegen in der Betonung des langfristigen Ansatzes und
in der integrativen Behandlung aller Politikfelder. Natürlich können sich
dabei Elemente der bisherigen Kommunalpolitik als nachhaltig erweisen, ohne
dass dieses Ziel in der Vergangenheit explizit verfolgt wurde.
Die Beteiligung der Bevölkerung ist von großer Bedeutung. Die Bürger werden
als gleichwertige Verhandlungspartner beim Dialog innerhalb der Kommune
angesehen, was von der örtlichen Politik und Verwaltung eine echte
Bereitschaft zum Dialog und zur Kooperation erfordert."
[aus: Eick von Ruschkowski, Lokale Agenda 21 in Deutschland - eine Bilanz;
in: Aus Politik und Zeitgeschichte 31-32/2002, S. 19,
Online-Version] |
|
In der
Präambel der Agenda 21 heißt es:
"Die Menschheit steht an einem
entscheidenden Punkt ihrer Geschichte. Wir erleben eine zunehmende
Ungleichheit zwischen den Völkern und innerhalb von Völkern, eine
immer größere Armut, immer mehr Hunger, Krankheit und Analphabetentum
sowie eine fortschreitende Schädigung der Ökosysteme, von denen unser
Wohlergehen abhängt.
Durch eine Vereinigung von Umwelt- und Entwicklungsinteressen und ihre
stärkere Beachtung kann es uns jedoch gelingen, die Deckung der
Grundbedürfnisse, die Verbesserung des Lebensstandards aller Menschen,
einen größeren Schutz und eine bessere Bewirtschaftung der Ökosysteme
und eine gesicherte, gedeihlichere Zukunft zu gewährleisten.
Das vermag keine Nation allein zu erreichen, während es uns gemeinsam
gelingen kann; in einer globalen Partnerschaft, die auf eine
nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist."
[Den vollständigen Text in
mehreren Sprachen findet man im Online-Angebot der Vereinten Nationen:
AGENDA 21] |
|
Das Kapitel 28
der Agenda 21 beschäftigt sich mit der Rolle der Kommunen:
"Da viele der in der Agenda 21
angesprochenen Probleme und Lösungen auf Aktivitäten auf der örtlichen
Ebene zurückzuführen sind, ist die Beteiligung und Mitwirkung der
Kommunen ein entscheidender Faktor bei der Verwirklichung der in der
Agenda enthaltenen Zielen.
Kommunen errichten, verwalten und unterhalten die wirtschaftliche,
soziale und ökologische Infrastruktur, überwachen den Planungsablauf,
entscheiden über die kommunale Umweltpolitik und kommunale
Umweltvorschriften und wirken außerdem an der Umsetzung der nationalen
und regionalen Umweltpolitik mit. Als Politik- und Verwaltungsebene,
die den Bürgern am nächsten ist, spielen sie eine entscheidene Rolle
bei der Informierung und Mobilisierung der Öffentlichkeit und ihrer
Sensibilisierung für eine nachhaltige umweltverträgliche Entwicklung
(...).
Jede Kommunalverwaltung soll in einen Dialog mit ihren Bürgern,
örtlichen Organisationen und der Privatwirtschaft eintreten und eine 'lokale
Agenda 21' beschließen. Durch Konsultation und Herstellung eines
Konsenses würden die Kommunen von ihren Bürgern und von örtlichen
Organisationen, von Bürger-, Gemeinde-, Wirtschafts- und
Gewerbeorganisationen lernen und für die Formulierung der am besten
geeigneten Strategien die erforderlichen Informationen erlangen. Durch
den Konsultationsprozess würde das Bewusstsein der einzelnen Haushalte
für Fragen der nachhaltigen Entwicklung geschärft." |
|
Kritik an der
Agenda 21:
Nur ein Papiertiger?
"Der alles begründende Begriff
des 'Sustainable Development' ... umfasst eine Kompromissformel
zwischen den (legitimen) Ansprüchen von Ländern der Dritten Welt nach
mehr technisch-infrastruktureller Entwicklung und nach mehr Wohlstand
gegenüber den Ansprüchen von meist mehr nördlich dominierten
Naturschutzgruppen nach ... Artenschutz und langfristiger
Ressourcenschonung.
Diese auf den Ressourcenverbrauch und sozialen Ausgleich bezogene
Konfliktlinie hat eine naheliegende theoretische Lösung: die
hochindustrialisierte Welt muss ihren Ressourcenverbrauch rapide
senken, und der gering bzw. später industrialisierte Teil darf noch
zulegen, so dass insgesamt doch ... ein Ressourcenverbrauchsrückgang
eingeleitet werden kann.
Auf der Weltkonferenz in Rio ist nun aber nicht ein Vertrag
geschlossen worden, der zukünftige Ressourcenrechte in Umrissen
anvisiert und erleichternde Handelsbestimmungen für die ökonomisch
schwachen Nationen festlegt, sondern es ist mit der Agenda 21 eine
neue Schaubühne eröffnet worden: man setzt auf Planung mittels
Aushandlungsprozessen, d.h. auf freiwilligen Konsens für eine
nachhaltigere (Umwelt)entwicklung, wobei diffus Inhaltliches und viele
administrative und verfahrenstechnische Vorschläge des
Prozessmanagements genannt werden, es aber keinerlei konkrete
Begrenzungsangaben gibt (...).
Die Regierungsdelegationen der vielen anwesenden Länder haben das
bereitwillig unterzeichnet, weil nichts festgeschrieben wurde, das man
irgendwie einklagen könnte. Die beteiligten
Nichtregierungsorganisationen waren zufrieden, weil sie erstmalig
anerkannt waren und an einer solchen Konferenz Mitbestimmungsrechte
hatten (...).
Jeder Kenner der internationalen Szene musste voraussehen, dass
solcherlei internationale Proklamationen der ohnehin schwachen
Vereinten Nationen folgenlos verpuffen werden."
[aus: Heino Apel, Lokale Agenda 21 und Partizipation; in:
Ausserschulische Bildung 2/1999, S. 137] |
|
Angebot für bürgerschaftliches
Engagement
"Grundlage für einen erfolgversprechenden Agenda-Prozess ist eine breite und
engagierte Beteiligung möglichst vieler Akteure aus Politik, Verwaltung,
Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, Vereinen, Umwelt- und Nord-Süd-Gruppen
sowie vor allem von 'nicht organisierten' Bürgern. Damit stellt die Lokale
Agenda 21 ein interessantes Angebot für bürgerschaftliches Engagement dar.
Gerade die Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements, der
Freiwilligenarbeit und der Bürgerbeteiligung bei stadtplanerischen Projekten
können wesentliche Impulse für den Lokale-Agenda-21-Prozess liefern."
[aus: Klaus Hermanns, Die Lokale Agenda 21. Herausforderung für die
Kommunalpolitik; in: Aus Politik und Zeitgeschichte 10-11/2000,
S. 3,
Online-Version]
Phasen des Lokale-Agenda-21-Prozesses
Das folgende Schaubild zeigt die vier Phasen eines ideal verlaufenden Agenda-Prozesses.
Wichtig zu sehen ist, dass der Prozess nach der Evaluationsphase nicht endet. Es
handelt sich um einen fortlaufenden Lern-, Such- und Diskussionsprozess, bei dem
die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen in den nächsten Zyklus eingespeist
werden.
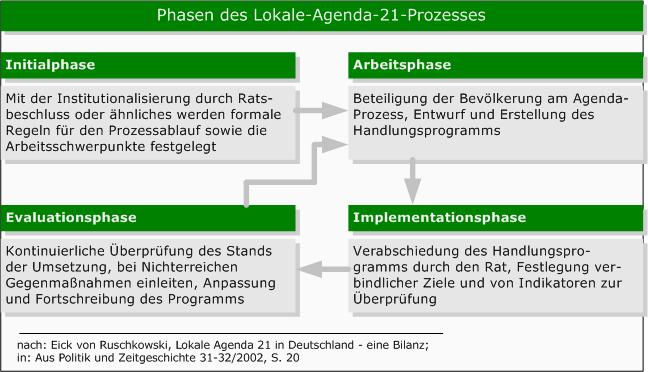
Was wurde bisher erreicht?
Der folgende Textauszug bilanziert die Situation 10 Jahre nach
Rio und am Vorabend der Rio-Nachfolgekonferenz 2002 in Johannesburg:
"Verglichen mit den Maßstäben, die die Agenda 21 1992 anlegte, fällt die Bilanz
... für die weltweiten Lokale-Agenda-21-Prozesse ernüchternd aus. Weder eine
Aufbruchstimmung, eine Mobilisierung der Massen noch ein einigermaßen adäquates
Zeitziel wurden erreicht. Allerdings kann der Handlungsauftrag aus Kapitel 28
der Agenda 21 nicht als realistischer Maßstab angesetzt werden. Zum Zeitpunkt
der Verabschiedung war die Lokale Agenda 21 nicht mehr als ein theoretisches
Konzept auf dem Papier, zu dem es keine Erfahrungen gab. Niemand konnte
vorausahnen, wie lange es dauern würde, das Konzept der Nachhaltigkeit in die
Gesellschaft zu tragen.
Als Schlussfolgerung ist eine differenzierte Betrachtung ratsam, die das bisher
Erreichte anerkennt, aber gleichzeitig konstatiert, dass es noch viel zu tun
gibt. Obwohl die Lokale Agenda 21 insgesamt in Bezug auf Reichweite und Erfolge
klar hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben ist, hat die
Agenda-Bewegung inzwischen weltweit Resonanz gefunden. Bisher ist die kritische
Masse noch nicht erreicht. Noch sind Lokale-Agenda-21-Prozesse eher Kür als
Pflicht, vielerorts werden wirkliche Konfliktthemen (z.B. kommunale Finanzen,
langfristige Stadtentwicklung, Integration bzw. Stärkung von Minderheiten etc.)
nicht in den Agenda-Prozessen behandelt.
Der Ansatz, das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung auf kommunaler Ebene zu
implementieren, birgt ein enormes Potenzial in sich, das aber von den Kommunen
entsprechend abgerufen und umgesetzt werden muss. Nach wie vor dominieren
kurzfristige, sektorale Handlungsprogramme die Politik."
[aus: Eick von Ruschkowski, Lokale Agenda 21 in Deutschland - eine Bilanz; in:
Aus Politik und Zeitgeschichte 31-32/2002, S. 24,
Online-Version]
Weitere Informationen zum Thema im Internet
 |
ICLEI steht für International Council for Local Environmental
Initiatives. Die Organisation mit Sitz in Toronto wurde
1990 von Lokalregierungen am UN-Hauptquartier in New York gegründet. |
Die Organisation
verfolgt Ziele, die eng mit der Lokalen Agenda 21 zusammenhängen: "ICLEI's
mission is to build and serve a worldwide movement of local governments to
achieve tangible improvements in global sustainability with special focus on
environmental conditions through cumulative local actions" (Mission Statement;
http://www.iclei.org/about.htm).
Das Online-Angebot von ICLEI bietet eine Fülle an Beispielen, Berichten und
Informationen zur Entstehung und zum Stand der Umsetzung der Lokalen Agenda 21
weltweit. Am besten findet man die Informationen ausgehend von folgender Seite:
http://www.iclei.org/ICLEI/la21.htm
[Autor: Ragnar Müller]
[Seitenanfang]
|