|
| |

|
"Eine nachhaltige
Landwirtschaft ist ökologisch tragfähig, ökonomisch existenzfähig,
sozial verantwortlich, ressourcenschonend und dient als Basis für
zukünftige Generationen." [P. Allen
u.a.] |
|
Wie handle ich nachhaltig? - Beispiel:
Nachhaltige Landwirtschaft
Natürlich sind es vor allem die Landwirte, die sehr viel auf dem Weg zu
einer nachhaltigen Landwirtschaft bewirken können. Aber wir alle können dazu
beitragen,
 |
indem wir Produkte
bevorzugen, die aus nachhaltiger Landwirtschaft stammen;
|
 |
indem wir regionale
Produkte bevorzugen, die keine langen Transportwege hinter sich haben;
|
 |
indem wir in
unserer eigenen "Landwirtschaft", etwa in unserem Garten darauf achten,
|
 |
dass wir
kompostierbare Abfälle kompostieren; |
 |
dass wir schonend
oder überhaupt nicht düngen; |
 |
dass wir keine
Pestizide (Schädlingsbekämpfungsmittel) und keine Herbizide (Unkrautvernichtungsmittel)
verwenden; |
 |
dass wir in unserem
Garten einheimische Pflanzen bevorzugen. |
|
Leitbild einer nachhaltigen Landwirtschaft
Der folgende Text nennt vier Grundsätze des Nachhaltigkeitsleitbildes, um
daraus ein agrarpolitisches Leitbild der Nachhaltigkeit abzuleiten.
Nachhaltige Entwicklung drückt sich dadurch aus, dass
"1. erneuerbare Ressourcen nur ihrer Regenerationsrate entsprechend genutzt
werden sollen;
2. endliche Rohstoffquellen nur insoweit einer anthropogenen Nutzung
unterzogen werden sollen, soweit diese sowohl in stofflicher als auch
funktionaler Sicht durch erneuerbare Ressourcenträger ersetzt werden und
gleichzeitig eine höhere Produktivität garantieren;
3. Umweltbelastungen nicht die natürlich vorgegebene Umweltkapazität der
Hauptumweltmedien Luft, Boden und Wasser bzw. deren Abbauleistung
übersteigen;
4. eine temporäre Äquivalenz zwischen Eintrags- bzw. Eingriffszeitpunkt
einerseits und zwischen natürlichen Zeiträumen und Prozessabläufen
andererseits bestehen soll.
Diese nun vordergründig sehr starke Ausrichtung auf die ökologische
Dimension des Nachhaltigkeitskonzepts ist entwicklungshistorisch dadurch
bedingt, dass die Nachhaltigkeitsdiskussion von Beginn an sehr stark mit
Fragen der ökologischen Modernisierung und einer innovationsorientierten
Umweltpolitik gekoppelt war. |
|
"Nachhaltige Landwirtschaft ...
 |
... arbeitet mit Methoden und
Verfahren, die die Produktivität des Bodens maximieren und gleichzeitig die
schädlichen Auswirkungen auf Boden, Wasser, Luft und Artenvielfalt sowie die
Gesundheit der Bauern und der Verbraucher minimieren; |
 |
... stellt Methoden und
Verfahren in den Mittelpunkt, die Ressourcen erhaltend sind; |
 |
... zielt darauf ab, so wenig
wie möglich nicht-erneuerbare und auf Erdölbasis hergestellte Betriebsmittel
einzusetzen und sie langfristig abzuschaffen. Sie werden durch erneuerbare
ersetzt; |
 |
... wendet Methoden und
Verfahren an, die an die jeweiligen örtlichen Verhältnisse angepasst sind; |
 |
... bezieht die Bauern und
Bäuerinnen mit ihrem Wissen, ihrem Können und ihren Fähigkeiten mit ein; ist partizipatorisch." |
[aus: Deutscher Bundestag (Hg.),
Schlussbericht der Enquete-Kommission "Globalisierung der Weltwirtschaft", S.
338,
Online-Version]
|
|
Dennoch darf dieser Sachverhalt nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch
ökonomische und soziale Funktionen gleichberechtigt behandelt werden müssen.
Letztgenannte Faktoren erfordern deshalb die Beachtung bestimmter Spielregeln
hinsichtlich einer inter- und intragenerationellen Verteilungsgerechtigkeit um
materielle und immaterielle Ressourcen. Letztendlich bedarf insbesondere die
ökonomische Komponente gesteigerter Aufmerksamkeit, da es für eine nachhaltige
Entwicklung von existenzieller Bedeutung ist, Wirtschaftsinteressen gezielt
einzubinden und zu regulieren. Die heute in großem Umfang um den Preis
ökologischer Degradation oder sozialer Ausbeutung realisierten kurzfristigen
Gewinne sind in einem der Nachhaltigkeit verpflichteten Wirtschaftssystem nicht
länger tolerierbar.
Die Extrapolation dieser Grundsätze auf die Agrarpolitik ergibt (...), [dass]
eine nachhaltige Agrarpolitik so ausgestaltet sein [soll], dass sie eine
Landwirtschaft ermöglicht, die
1. in ökonomischer Hinsicht durch unternehmerisches Handeln geprägt ist,
weitgehend ohne Subventionen auskommt und somit wettbewerbsfähig ist. Die in der
Agrarwirtschaft Beschäftigten erzielen ihr Einkommen nicht nur durch die
Erzeugung gesunder Lebensmittel und deren teilweise regional gebundene
Direktvermarktung und Weiterverarbeitung, sondern im Sinne einer
multifunktionalen Landwirtschaft auch durch die Erschließung weiterer
Erwerbsquellen im Tourismussektor, durch den Anbau nachwachsender Rohstoffe oder
die Erzeugung von Energie aus Biomasse. Darüber hinaus ergeben sich weitere
Einkommensmöglichkeiten durch die staatliche Honorierung von Naturschutz- und
Landschaftspflegeleistungen;
2. in der ökologischen Dimension mit den natürlichen Ressourcen Boden,
Luft und Wasser so umgeht, dass diese auch vor langfristigen negativen
Einflüssen geschützt sind. Das bedeutet konkret, dass Dünge- und
Pflanzenschutzmittel so sparsam und sorgfältig eingesetzt werden, dass
angrenzende unkultivierte Bereiche und Gewässer nicht beeinträchtigt werden. Die
Bewirtschaftungsform soll ferner eine artenreiche und vielfältige
Kulturlandschaft erhalten, wobei es auch das genetische Potenzial alter
Kulturpflanzensorten und Haustierrassen zu bewahren gilt;
3. im sozialen Bereich sichere Arbeitsplätze im ländlichen Raum
bereitstellt (...);
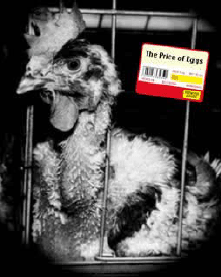 |
4. in den ethischen Fragen des Tierschutzes gewährleistet, dass
Nutztiere sowohl in der Haltung als auch der Zucht und Fütterung tiergerecht
behandelt und nicht unnötig gequält werden;
5. den Verbraucherschutz zu einem neuen politischen Paradigma macht.
Der mit der Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg in einem fordistischen
Produktionssystem abgeschlossene historische Kompromiss, gegen
Einkommenssicherheit die Bereitstellung einer ausreichenden
Lebensmittelversorgung für die städtischen Ballungsgebiete und die
Industriebeschäftigten zu gewährleisten, hat in dieser Schlichtheit
ausgedient. Dieser Kompromiss ist mit dem gesellschaftlichen Strukturwandel
nunmehr selbst in Gefahr geraten. Die wachsende Skepsis gegenüber der
Dauersubventionierung bestimmter Produkte, und zwar unabhängig von ihrer
Qualität und den Drittwirkungen, die ihre Herstellung auslöst, geht einher
mit dem Anwachsen neuer sozialer Milieus, die andere und qualitativ höhere
Ansprüche an Nahrungsmittel stellen. |
Nachgefragt werden gesunde, nahrhafte und unter ökologischen und
Tierschutzaspekten unbedenkliche Nahrungsmittel. Auskunftsansprüche des
Verbrauchers gegenüber Behörden und sowohl Lebensmittel erzeugenden als auch
vertreibenden Unternehmen helfen neben umfassenden Kennzeichnungspflichten, die
Kultur des Misstrauens in eine Kultur des Vertrauens zu wandeln. Aber auch der
mündige Verbraucher ist gefordert, durch sein Einkaufsverhalten eine nachhaltige
Agrarpolitik zu honorieren und den Teufelskreis des dominierenden
Preiswettbewerbs im Einzelhandel zu durchbrechen."
[aus: Holger Meyer/Wilfried Gaum, 10 Jahre nach Rio – Wie nachhaltig ist die
Agrarpolitik?; in: Aus Politik und Zeitgeschichte 31-32/2002, S. 28-29,
Online-Version]
Biodynamischer Anbau
 |
Weltweit bauen immer mehr Landwirte ihre Produkte "biodynamisch" oder "organisch"
an. Was heißt das? In erster Linie bedeutet das, dass sie Techniken anwenden,
die nicht auf die chemischen und genetischen Substanzen und Technologien der
Agroindustrie zurückgreifen, sondern auf ökologischem Wissen basieren.
Ohne schädliche "Nebenwirkungen" können sie dadurch die Erträge steigern,
Schädlinge unter Kontrolle halten und den Boden fruchtbar halten. Eine
wichtige Rolle dabei spielt, dass sie auf große Monokulturen (siehe Foto),
wie sie im Zuge der Kolonialisierung vielerorts entstanden sind, verzichten. |
"Sie bauen eine Vielfalt von Feldfrüchten an, nach dem Prinzip des
Fruchtwechsels, so dass Insekten, die von einer Sorte angezogen werden, bei der
nächsten verschwinden. Sie wissen, dass es unklug ist, Schädlinge völlig
auszurotten, weil das auch ihre natürlichen Verfolger eliminieren würde, die ein
gesundes Ökosystem im Gleichgewicht halten. Statt mit Kunstdünger reichern diese
Bauern ihre Felder mit Gülle und untergepflügten Pflanzenresten an, und damit
geben sie dem Boden organische Materie zurück, die so wieder in den biologischen
Kreislauf gelangt."
[aus: Fritjof Capra, Verborgene
Zusammenhänge. Vernetzt denken und handeln - in Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft, Bern u.a. 2002, S. 248]
Biodynamischer Anbau ist nachhaltig, weil er im Einklang mit den ökologischen
Prinzipien steht. Er stellt das gesamte komplexe Ökosystem, in dem und
von dem er lebt, in Rechnung und fügt sich in die natürlichen Zyklen ein. Diese
ganzheitliche Herangehensweise ist ein zentraler Bestandteil jeder
Vorgehensweise, die nachhaltig sein will.
"Biobauern wissen, dass ein fruchtbarer Boden ein lebendiger Boden ist, der in
jedem Kubikzentimeter Milliarden lebender Organismen enthält - ein komplexes
Ökosystem also, in dem die Substanzen, die für das Leben wichtig sind, sich in
Zyklen von den Pflanzen zu Tieren, Dünger, Bodenbakterien und wieder zu den
Pflanzen zurück bewegen. Die Sonnenenergie ist der natürliche Brennstoff, der
diese ökologische Zyklen antreibt."
[aus: Fritjof Capra, Verborgene
Zusammenhänge. Vernetzt denken und handeln - in Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft, Bern u.a. 2002, S. 248-249]
|
Als Leitmotiv für nachhaltige
Landwirtschaft könnte man formulieren:
Von der Natur lernen statt sie beherrschen und manipulieren zu wollen!
|
Oft wird eingewendet, dass mit einer nachhaltigen Produktionsweise der
steigende Nahrungsbedarf der schnell wachsenden Weltbevölkerung nicht gedeckt
werden könne. Nach den Erfahrungen und Forschungen der letzten Jahre kann dieser
Einwand als widerlegt gelten. Fritjof Capra fasst einige interessante Ergebnisse
einer internationalen Konferenz über nachhaltige Landwirtschaft, die 1999 im
italienischen Bellagio stattfand, zusammen:
In Bellagio haben Wissenschaftler berichtet, "dass eine Reihe groß angelegter
experimenteller Projekte auf der ganzen Welt, bei denen agroökologische
Techniken - Fruchtwechsel, 'Intercropping' (der Anbau weiterer Pflanzen), der
Einsatz von Mulchen und Kompost, Terrassenanbau, Wasseranbau usw. - spektakuläre
Ergebnisse erbracht hätten, und zwar großteils in ressourcenschwachen Gebieten,
die man für ungeeignet zur Erzielung von Nahrungsüberschüssen gehalten hatte.
Zum Beispiel führten agroökologische Projekte, an denen etwa 730 000 bäuerliche
Haushalte in ganz Afrika beteiligt waren, zu Ertragszuwächsen zwischen 50 und
100 Prozent, während die Produktionskosten zurückgingen und damit die Einkünfte
der Haushalte dramatisch zunahmen - zuweilen um das Zehnfache. Immer wieder
zeigte sich, dass die biodynamische Landwirtschaft nicht nur die Produktion
erhöht und eine große Vielfalt ökologischer Vorteile bietet, sondern auch den
Bauern zugute kommt."
[aus: Fritjof Capra, Verborgene
Zusammenhänge. Vernetzt denken und handeln - in Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Gesellschaft, Bern u.a. 2002, S. 250]
Der gesamte Bericht wird an verschiedenen Stellen im Internet als pdf-Datei [750
kb] zum Download angeboten, unter anderem auf folgender Seite:
http://www.rodaleinstitute.org/international/conference/bellagio.pdf
|
"Wer Waren aus
deklariert fairem Handel kauft, übernimmt globale Verantwortung, wer
Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft kauft, schützt uns und unsere
Umwelt, wer auf regionale heimische Qualität im Einkaufskorb setzt, sorgt
für weniger Verkehrsbelastung, sichert Arbeitsplätze und die
Wirtschaftskraft in den ländlichen Regionen."
[aus: umwelt & bildung 03/2004, S. 9] |
[Autor: Ragnar Müller]
[Seitenanfang]
|