|
| |
Aktivierende Methoden des Politikunterrichts
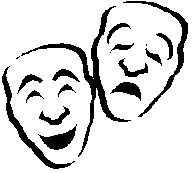
Unterscheidung: Planspiel und Rollenspiel |
Rollen- und Planspiel
Nach einer gängigen Typologie zählen Rollenspiele ebenso wie Planspiele zur
Gruppe der Simulationsspiele, was bereits auf ein wesentliches Merkmal der
Methoden hinweist: Realität wird im Unterricht oder Seminar simuliert.
Dabei wird die Komplexität der Realität reduziert, gleichzeitig muss das
Modell aber repräsentativ bleiben, also im Kern mit der Realität
übereinstimmen. Dieses grundlegende Spannungsverhältnis eignet allen
Simulationsspielen.
Während es beim Planspiel in der Regel darum geht, eine Institution
oder eine bestimmte Position zu einem politischen Problem zu vertreten (eher
abstrakt), schlüpfen die Teilnehmer eines Rollenspiels in die
Rolle eines bestimmten Menschen (eher konkret). Natürlich sind beide Methoden eng verwandt
und überschneiden sich, weswegen sie hier gemeinsam vorgestellt werden.
|
|
Planspiel ist voraussetzungs-
reicher |
Man kann das
Planspiel auch als eine besondere Unterform des Rollenspiels auffassen:
Demnach sind Planspiele "komplex gemachte Rollenspiele mit klaren
Interessengegensätzen und hohem Entscheidungsdruck".
[aus: Hilbert Meyer, Unterrichtsmethoden II: Praxisband, Frankfurt/Main
1987, S. 366]
Während also ein Rollenspiel alles mögliche simulieren kann (eine Talkshow,
Konflikt in der Klasse etc.), sind Planspiele voraussetzungsreicher: Man
benötigt ein umstrittenes politisches Problem, mehrere Akteure mit
unterschiedlichen Interessen und vor allem eine Entscheidungssituation, die
mit dem Planspiel simuliert werden kann (Konferenz, Gemeinderatssitzung, UN-Generalversammlung
etc.). Der Konflikt ist im Spiel zu lösen, so dass man von einem
Probehandeln mit Ernstcharakter sprechen kann.
|
|
Ziel des Planspiels |
"Ziel von
Planspielen ist es, die komplexe politische und/oder gesellschaftliche
Wirklichkeit, schwer zugängliche Zusammenhänge und Prozesse überschaubar und
damit transparent zu machen".
[aus: Peter Massing, Planspiele und Entscheidungsspiele; in:
Methodentraining für den Politikunterricht. Themen und Materialien,
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2004, S. 165]
Planspiele werden in der Regel nicht am Anfang, sondern gegen Ende einer
Unterrichtseinheit eingesetzt, wenn bereits fundierte Informationen über ein
Thema vorhanden sind. Der Ablauf von Rollenspielen und Planspielen stellt
sich ähnlich dar und umfasst in der Regel folgende Phasen:
|
|
Ablauf eines Planspiels
4 Phasen |
 |
Phase 1:
Vermittlung der Ausgangslage
Um die im Planspiel dargestellte Konfliktsituation bearbeitbar zu machen,
werden zunächst allgemeine Informationen über die Ausgangslage des Konflikts
gegeben. Der Konflikt wird geschildert und die zum Konflikt gehörigen
Gruppen werden in ihren spezifischen Positionen, Funktionen und ihren Rollen
grob skizziert.
|
 |
Phase 2:
Einarbeiten in die Rollen
Hier
geht es darum, sich mit der im Konflikt vertretenen Rolle vertraut zu machen.
Was ist die Ausgangslage, welche Funktion und Position wird eingenommen,
welche Kompetenzen sind vorhanden und was ist die Aufgabe in dem
spezifischen Konflikt. Dann geht es um die Identifikation mit der eigenen
Rolle, um die Entwicklung eines Standpunktes und schließlich darum,
Strategien für das Vorgehen zu entwickeln (Verbündete, Maßnahmen etc.).
|
 |
Phase 3:
Durchführung des Spiels
Das ist das Herzstück des Planspiels. Hier treffen die verschiedenen Gruppen
und Interessen aufeinander, setzen sich über den Konflikt auseinander und
fällen die Entscheidung zur Konfliktlösung. Je nach Design des Spiels gibt
es vor der simulierten Entscheidungssitzung eine Phase, in der die Gruppen
interagieren, Koalitionen schmieden etc., um so die Entscheidung im Vorfeld
optimal im jeweiligen Sinne zu beeinflussen.
|
 | Phase 4: Auswertung
Das Spiel wird zunächst im Hinblick auf die unmittelbaren Erlebnisse,
Erfahrungen und Erkenntnisse ausgewertet. Die inhaltliche Auswertung
bildet einen entscheidenden Aspekt der Methode. Je nach Thematik kann und
sollte dann die Übertragbarkeit auf die Realität diskutiert werden.
|
|
|
Materialien für ein Planspiel |
Der Erfolg eines
Planspiels steht und fällt mit der Qualität der Spielmaterialien. Zur
Durchführung eines Planspiels benötigt man mindestens folgende Unterlagen:
 | Fallstudie: Hierbei handelt es
sich um eine kurze, verständlich geschriebene und übersichtliche
Einführung in die Problematik, die gleichzeitig auch in einer ersten
Übersicht die wichtigsten Akteure und ihre Interessen benennt und
beschreibt.
|
 | Arbeitskarte: Sie gibt allgemeine
Hinweise zum Spielverlauf und enthält die Planungs- und
Entscheidungsfragen, die im Spielverlauf zu verhandeln sind. Auch sie
sollte kurz und verständlich gehalten werden.
|
 | Rollenkarten: Während alle
Teilnehmer des Planspiels dieselbe Fallstudie und Arbeitskarte erhalten,
sind die Rollenkarten natürlich für jede Gruppe verschieden. Hier wird die
Rolle beschrieben, die die Gruppe übernehmen soll. Außerdem kann sie
Hinweise auf mögliche Aktivitäten enthalten, mit deren Hilfe der
entsprechende Akteur seine Interessen im Verlauf des Planspiels verfolgen
könnte. Sie kann auch noch Zusatzinformationen oder Denkanstösse zu diesen
Vorgaben umfassen.
|
 | Informationsmaterialien: Als
viertes Element sind häufig ergänzende Materialien erforderlich, die
notwendige Hintergrundinformationen enthalten, um dem Planspiel auf der
sachlich-inhaltlichen Ebene eine ausreichende Grundlage zu geben. Dabei
kann es sich um ganz unterschiedliche Quellen handeln: Ausschnitte aus
Primärquellen, wie Verwaltungs- oder Gesetzesvorschriften; echte oder für
das Planspiel erstellte Briefe von Behörden; Grafiken und Karikaturen;
echte oder gestellte Leserbriefe und Zeitungsberichte; Ausschnitte aus
Lexika, echte Stellungnahmen von Regierung, Interessengruppen etc. Diese
Unterlagen stehen allen Gruppen zur Verfügung. In den Rollenkarten können
einzelne Gruppen gezielt auf für sie wichtige und interessante
Hintergrundmaterialien hingewiesen werden. |
Neben diesen
Spielunterlagen kann es sinnvoll sein, Ereigniskarten bereitzuhalten,
mit deren Hilfe die Spielleitung während des Spiels Einfluss auf den Ablauf
nehmen kann. Ein weiteres, häufig vorhandenes Element sind
Arbeitsformulare, eine technische Hilfe für die Interaktionsphase. Das
können zum Beispiel Protokollbögen für Besprechungen sein, auf denen die
Gruppen Verhandlungsergebnisse festhalten können etc.
|
|
Einsatz-
möglichkeiten |
"Handeln im
Planspiel heißt vor allem Analyse von Problemen, Abwägen von Alternativen,
Entwicklung von Strategien und Taktiken sowie Treffen von Entscheidungen zur
Realisierung der aufgestellten Ziele. Planspiele sind daher im Allgemeinen
dort einsetzbar, wo formale politische Prozesse sowie Systemmechanismen
deutlich gemacht, wo Abhängigkeiten einzelner und Gruppen von vorgegebenen
Strukturen und Systemen veranschaulicht und Einsichten in Interessenlagen,
Machtstrukturen und Entscheidungszwänge verdeutlicht werden sollen.
Planspiele sind daher immer problem- und nicht wissensorientiert."
[aus: Peter Massing, Planspiele und Entscheidungsspiele; in:
Methodentraining für den Politikunterricht. Themen und Materialien,
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2004, S. 165-166]
|
|
Vorteile des Planspiels |
Wenn man selbst
etwas tut, ist der Lernerfolg besonders nachhaltig. Diese Erkenntnis
spricht für handlungsorientierte Methoden wie das Planspiel. Außerdem lässt
sich häufig eine höhere Lernmotivation beobachten. Schülerinnen oder
Seminarteilnehmer machen im Planspiel Erfahrungen, die sonst nicht
gemacht werden könnten. Sie üben im Verlauf des Planspiels eine Fülle von
Schlüsselqualifikationen ein, die ihre Demokratiekompetenz wesentlich
erweitern (Konflikte austragen, Interessen erkennen, Probleme definieren,
Ziele formulieren, Entscheidungen treffen, Verhandeln, Diskutieren,
Analysieren, Recherchieren etc.).
|
|
Nachteile bzw. Gefahren |
Diesen Vorzügen
stehen eine Reihe von Gefahren gegenüber, die sich mit dem Einsatz von
Planspielen verbinden: "So besteht immer die Tendenz, dass das Planspiel
unkritisch auf die Wirklichkeit übertragen und so ein falsches Bild der
politischen Realität vermittelt wird, in die eine Reihe von Faktoren
einfließen, die im Spiel unberücksichtigt bleiben müssen."
[aus: Peter Massing, Planspiele und Entscheidungsspiele; in:
Methodentraining für den Politikunterricht. Themen und Materialien,
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2004, S. 166]
Planspiele können unter- und überkomplex sein. Im ersten Fall wird die
Realität nicht angemessen widergespiegelt, im zweiten Fall scheitert der
Einsatz am zu hohen Aufwand. Planspiele stellen ohne Zweifel hohe
Anforderungen (inhaltlich, methodisch, sozial) an Lehrende und Lernende,
häufig trauen Lehrende ihren Schülern den Einsatz einer solch
voraussetzungsreichen Methode deshalb nicht zu.
Das kann zu einem Teufelskreis führen, der unbedingt durchbrochen
werden muss: "Schülerinnen und Schüler haben keine Methoden-, Sozial- und
Gesprächskompetenz, deshalb schrecken Lehrerinnen und Lehrer davor zurück,
entsprechende Methoden einzusetzen; mit der fatalen Folge, dass die
Schülerinnen und Schüler sie auch nicht erwerben können. Dieser Kreislauf
ist nur durch den Einsatz von handlungsorientierten Methoden zu durchbrechen."
[aus: Peter Massing, Planspiele und Entscheidungsspiele; in:
Methodentraining für den Politikunterricht. Themen und Materialien,
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2004, S. 168]
Außerdem ist natürlich in Rechnung zu stellen, dass Planspiele sich nur
schwierig in den organisatorischen Alltag einbinden lassen (Zeitaufwand,
mehrere Räume, lebhaftes Treiben etc.). Viele Erfahrungen sprechen jedoch
dafür, dass sich der - zugegebenermaßen große - Aufwand lohnt. "Die
TeilnehmerInnen erleben in der Auseinandersetzung mit anderen
Spielgruppen, wie soziale und politische Interaktionen ablaufen können,
welche Informationen sie für ihr Handeln benötigen und welche Gegebenheiten
und Strukturen Lösungen fördern oder behindern. (...) Planspiele fördern
ganzheitliches Lernen und selbstbestimmtes Handeln. Sie wollen zu kreativen
Problemlösungen, Konfliktlösungsstrategien oder Entscheidungsalternativen
Impulse geben."
[aus: Günther Gugel, Praxis politischer Bildungsarbeit. Methoden und
Arbeitshilfen,
Institut für Friedenspädagogik Tübingen, 4. Auflage 1996, S. 245, 247] |
[Autoren: Ragnar Müller/Prof. Dr. Wolfgang
Schumann]
[Seitenanfang]
|