|
| |
Die Entwicklung der Vereinten
Nationen (III):
Die Vereinten Nationen nach dem Ende des Kalten Krieges
(1989-2004)
Die epochalen Umbrüche der Jahre 1989/90 "rückten die Vereinten Nationen nach
Jahrzehnten der weitgehenden Lähmung fast schlagartig wieder ins Zentrum des
internationalen Politikgeschehens. Der
Sicherheitsrat ... erlangte eine bis
dahin nicht gekannte Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit" (Gareis/Varwick).
Die Initiative ging dabei von der Sowjetunion aus, wie der folgende Textauszug
von Helmut Volger schildert:
"Bis Ende der achtziger Jahre waren - vor allem in der Friedenssicherung und
Konfliktschlichtung - die Möglichkeiten der Vereinten Nationen relativ
beschränkt geblieben, weil das entscheidende UN-Organ, der Sicherheitsrat, durch
die mangelnde Zusammenarbeit der beiden Supermächte USA und UdSSR kaum
arbeitsfähig war. Zwar war es in der Phase der Entspannungspolitik nach der
Kuba-Krise zu einer begrenzten Kooperation der Großmächte gekommen, sie wurde
aber immer wieder von Krisen unterbrochen.
So war der Sicherheitsrat z.B. nicht in der Lage, im Afghanistan-Konflikt und im
Golfkrieg zwischen Irak und Iran wirksam zu handeln, weil in beiden Konflikten
beide Großmächte beteiligt waren: im Afghanistan-Konflikt die UdSSR als
Aggressor und die USA als Waffenlieferant für die afghanischen
Widerstandsgruppen, im Iran-Irak-Krieg beide Großmächte als Waffenlieferanten.

 |
Erst ein radikaler
Kurswechsel der UN-Politik der UdSSR im Kontext des neuen außenpolitischen
Konzepts von Gorbatschow, der nach einigem Zögern von ähnlichen politischen
Schritten der USA in den Vereinten Nationen beantwortet wurde, ermöglichte
einen grundlegenden Wandel der Arbeit der Vereinten Nationen (...). Ihren
stärksten Ausdruck fand der neue Kurs der UdSSR in einer Rede, die
Gorbatschow am 7. Dezember 1988 vor der UN-Generalversammlung hielt (...).
Er sprach sich für eine Stärkung der Vereinten Nationen aus und hob die
neuen Herausforderungen und Möglichkeiten hervor."
[aus: Helmut Volger, Zur Geschichte der
Vereinten Nationen; in: Aus Politik und Zeitgeschichte 42/1995, Bundeszentrale
für politische Bildung Bonn, S. 9]
Nach anfänglichem Zögern der USA unter Reagan kam es - vor allem unter
seinem Nachfolger George Bush - zu einer regen Zusammenarbeit: "Die Zahl der
Vetos ging gegen Null, während es umgekehrt zu einer explosionsartigen
Zunahme im Konsens verabschiedeter Resolutionen und Maßnahmen kam" (Gareis/Varwick).
Der erste Golfkrieg zwischen Iran und Irak konnte beendet werden, ebenso der
Konflikt in Afghanistan.
In beide Konfliktzonen wurden Friedensmissionen entsandt, deren Zahl nun
sprunghaft anstieg: Blauhelme mauserten sich von einer Randerscheinung der
internationalen Politik zu einem zentralen Instrument. 1988 erhielten sie
den Friedensnobelpreis. Außerdem konnten die Konflikte in Angola, Namibia,
Kambodscha und in der Westsahara erfolgreich geschlichtet werden. Wie schon
in der Gründungsphase der
Vereinten Nationen machte sich ein großer Optimismus breit. George Bush
sprach von einer "new world order", in der den Vereinten Nationen eine
wichtige Rolle zukam.
"Der Überfall des Iraks auf Kuwait machte die Hoffnungen auf eine Welt ohne
zwischenstaatliche Kriege zunichte und der konfliktträchtige Zerfall von
Staaten in Afrika (Somalia) und Europa (Jugoslawien) stellte die
Weltorganisation vor gänzlich neue Herausforderungen. Die Vereinten Nationen
sahen sich ferner in zunehmenden Maße mit innerstaatlichen
Auseinandersetzungen konfrontiert. |
Eine schrittweise Ausdehnung der
Befugnisse des Sicherheitsrats auf Vorgänge, die wenige Jahre zuvor noch unter
das Nichteinmischungsgebot der Charta
gefallen wären, war die Folge und gleichzeitig die Voraussetzung für die
Schaffung einer neuen Generation von VN-Friedensmissionen (...). Zwischen 1988
und 1992 wurden ... 14 neue Missionen eingerichtet, mehr als in den vier
vorangegangenen Jahrzehnten zusammen (...). Allein im Jahr 1993 kamen weitere
sechs Friedenseinsätze hinzu und trotz eines zeitweiligen faktischen Moratoriums
in der Mitte der 1990er Jahre erhöhte sich die Zahl der VN-Friedensmissionen auf
insgesamt 54 bis zum Jahr 2001."
[aus: Sven Gareis/Johannes
Varwick, Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen;
Bundeszentrale für politische Bildung Schriftenreihe Band 403, Bonn 2003, S.
125]
Weltkonferenzen der 1990er Jahre
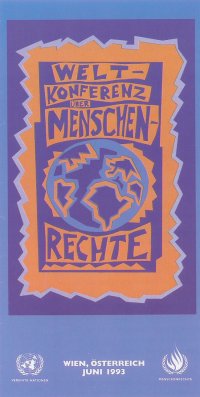 |
"Mussten die Vereinten Nationen in den siebziger und achtziger Jahren -
vor allem durch den Widerstand der Industrieländer gegen kostenträchtige
multilaterale Hilfsprogramme und gegen die Forderung nach Umstrukturierung des
Weltwirtschaftssystems [siehe
vorhergehender Abschnitt] - in ihrem Bemühen, die zunehmenden sozialen,
ökonomischen, ökologischen und humanitären Probleme in vielen ihrer
Mitgliedstaaten ... zu lindern, wiederholt Niederlagen einstecken, versuchten
sie in den neunziger Jahren, durch intensiv vorbereitete Konferenzen
Lösungskonzepte für die immer akuter werdenden globalen Probleme zu finden (...)
[eine Übersicht über wichtige Weltkonferenzen steht im
Themenkomplex Globalisierung zur Verfügung].
Im Ergebnis sind bei allen Konferenzen sowohl Erfolge als auch
Niederlagen zu verzeichnen. Als Erfolg ist die große Beteiligung der NGOs zu
bewerten, die starke Präsenz von Spitzenpolitikern der Mitgliedstaaten und das
breite Echo der Konferenzen in den Massenmedien. Nur Teilerfolge gab es
hinsichtlich völkerrechtlich verbindlicher Abkommen zu verzeichnen, in der Regel
ließ man es bei Absichtserklärungen und Aktionsprogrammen bewenden; lediglich
bei der Umweltkonferenz in Rio verabschiedete man zwei Rahmenkonventionen zum
Artenschutz und zum Klimaschutz, die allerdings zu ihrer Wirksamkeit noch
inhaltlicher Festlegungen durch weitere Konferenzen bedürfen."
[aus: Helmut Volger, Zur Geschichte der
Vereinten Nationen; in: Aus Politik und Zeitgeschichte 42/1995, Bundeszentrale
für politische Bildung Bonn, S. 11]
Trotz der fehlenden Verbindlichkeit vieler Erklärungen zu den
Weltproblemen haben sich die Vereinten Nationen als Forum zur kontinuierlichen
Bearbeitung globaler Probleme etabliert. In allen
Global Governance-Konzepten spielen sie - als nach wie vor einzige globale
Organisation - eine zentrale Rolle. Die entscheidende Schwierigkeit von
Politikformen, die der Globalisierung der Probleme gerecht werden wollen,
besteht darin, Regieren jenseits des Nationalstaats effektiv und gleichzeitig
demokratisch zu organisieren. Es zählt nach wie vor zu den drängenden Problemen
der Politikwissenschaft, hierfür innovative Modelle zu entwickeln. |
Die Bilanz im Bereich Friedenssicherung
Auch für diese Phase in der Entwicklung der Vereinten Nationen fällt die Bilanz
hinsichtlich der Hauptaufgabe, der Sicherung des Friedens und der
internationalen Sicherheit, gemischt aus. Den oben erwähnten anfänglichen
Erfolgen - vor allem auch der Namibia-Operation beim Übergang des Landes in die
Unabhängigkeit - stehen schwere Fehlschläge unter anderem in Somalia und Bosnien
gegenüber, die dem Ansehen der Weltorganisation nachhaltigen Schaden zugefügt
haben.
Wie schon bei der Kongo-Mission 1960 [siehe
vorheriger Abschnitt] wurden die Blauhelme zunehmend mit Aufgaben
überfordert, für die sie nicht geschaffen worden waren und die sie deshalb auch
nicht erfüllen konnten: "Waren die klassischen Friedensmissionen ... vornehmlich
durch ihre Funktion als Puffer zwischen den Streitkräften der in der Regel
staatlichen Konfliktparteien gekennzeichnet, so waren die Mandate in der 'Zweiten
Generation' durch ein immer breiteres Aufgabenspektrum geprägt.
Hilfen für Staaten in Übergangs- oder nationalen Versöhnungsprozessen,
Unterstützung demokratischer Konsolidierungsprozesse, Entwaffnung und
Reintegration von Bürgerkriegsarmeen, Repatriierung von Flüchtlingen und
schließlich die zeitweise Übernahme quasi-hoheitlicher Befugnisse für ein ganzes
Land gehörten zu den neuen Aufgaben der Friedensmissionen."
[aus: Sven Gareis/Johannes
Varwick, Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen;
Bundeszentrale für politische Bildung Schriftenreihe Band 403, Bonn 2003, S.
127]
Solche Missionen der zweiten Generation wurden nicht nur in Namibia, sondern
relativ erfolgreich auch in Nicaragua, El Salvador, nach der vom Sicherheitsrat
mandatierten Befreiung Kuwaits an der dortigen Grenze zum Irak und in Kambodscha
durchgeführt, wo in der bis dahin größten und teuersten Mission eine
vollständige Übergangsverwaltung eingerichtet wurde. Diesen Einsätzen war
gemeinsam, dass sie insofern in der Tradition des klassischen Peacekeeping
standen, als sie nicht in, sondern nach kriegerischen Konflikten
stattfanden, wie der folgende Textauszug hervorhebt:
"Die Fortentwicklung der Peacekeeping-Doktrin in der 'Zweiten Generation' war
insofern eher gradueller Natur, als dass die Missionen in Post-Conflict-Situationen,
also in einem weitgehend friedlichen Umfeld stattfanden und auf zuvor
ausgehandelten Friedensabkommen bzw. dem Konsens zwischen den Konfliktparteien
aufbauten. Einige der nach 1992 erfolgten Friedenseinsätze jedoch gerieten mit
den bewährten Grundsätzen der Blauhelm-Konzeption in Konflikt (...).
Mit UNOSOM II wurde in Somalia erstmals seit dem Kongo-Engagement ein
Mandat für eine Friedenstruppe nach den Bestimmungen des Kapitels VII der Charta
mit der Ausübung von militärischem Zwang verbunden. Doch verfehlte diese erste
humanitäre Intervention der Vereinten Nationen ... ihr Ziel, die einander
bekämpfenden Clanmilizen zu entwaffnen und die humanitäre Hilfe für die
Bevölkerung dauerhaft zu gewährleisten. Die Blauhelme gaben nach dem Tod von 24
pakistanischen Soldaten ihre Neutralität auf und wurden selbst zur
Konfliktpartei (...). UNOSOM II scheiterte nicht zuletzt an diesem
Grundwiderspruch: Statt einen zwischen den Parteien ausgehandelten Frieden zu
sichern, sollten die Blauhelme diesen erzwingen und wurden unter erheblichen
Verlusten zur Konfliktpartei.
Die Einsätze der UNPROFOR im ehemaligen Jugoslawien wiederum waren in
ihren Anfängen durch den Versuch geprägt, klassisches Peacekeeping zu
praktizieren. Doch zeigte sich schnell, wie unzulänglich ein bewährtes
Instrument in einem Kontext wirkt, für den es nicht geschaffen wurde. Blauhelme
wurden disloziert, ohne dass ein verlässliches Abkommen zwischen den Parteien
die Grundlage hierfür gebildet hätte. Die 1992 in Kroatien begonnene Mission
weitete sich ab 1993 durch schleichende Ausweitung des Mandats ... in eine
Intervention zum Schutz der Zivilbevölkerung vor massiven
Menschenrechtsverletzungen nach Bosnien-Herzegowina aus.

[Boutros Boutros-Ghali,
UN-Generalsekretär
1991-1996] |
Zwar hatte der
Generalsekretär mehrfach eindringlich davor gewarnt, der Friedenstruppe
Aufgaben zu übertragen, für die sie nicht geeignet ist. Die dennoch unter
dem Druck der Ereignisse erfolgte sukzessive Ausweitung des UNPROFOR-Mandats
fand keine Entsprechung in der militärischen Ausstattung und der rechtlichen
und politischen Klarstellung der Spielregeln des Einsatzes ... Die Blauhelme
wurden in mehreren Fällen als Geiseln genommen ... und gerieten zwischen die
Fronten, von denen zudem häufig nicht klar war, ob sie durch reguläre
Streitkräfte oder so genannte warlords gebildet wurden (...).
Die gescheiterten Missionen in Somalia und dem ehemaligen Jugoslawien
symbolisieren den Beginn der Krise des VN-Peacekeeping und der
Friedenssicherung durch die Vereinten Nationen insgesamt. Die Erfahrungen
mit dem vielfach so genannten Peacekeeping der 'Dritten Generation', in
deren Verlauf die Durchsetzung der Blauhelmmandate um die Mittel des Zwangs
und der militärischen Gewalt erweitert wurden, fielen zwiespältig aus. So
bewirkten die weltweit verbreiteten Bilder von getöteten US-Soldaten in
Somalia oder die Geiselnahme von VN-Friedenstruppen in Bosnien-Herzegowina
einen dramatischen Rückgang in der Bereitschaft vieler Staaten, ihre
Soldaten in schwierigen Missionen in Gefahr zu bringen.
|
 |
Die Einnahme der UN-Schutzzone
Srebrenica durch die bosnischen Serben im Juli 1995 (bei der mindestens 7.000
Bosnier, die vergeblich auf den Schutz der Vereinten Nationen vertraut hatten,
getötet wurden) wurde zu einem Symbol für das Versagen der UNO in konkreten
Konfliktsituationen."
[aus: Sven Gareis/Johannes
Varwick, Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen;
Bundeszentrale für politische Bildung Schriftenreihe Band 403, Bonn 2003, S.
128-130]
In Ruanda wurden trotz der Präsenz einer UN-Friedensmission über 800.000
Menschen ermordet, bevor man sich auf ein militärisches Eingreifen einigen
konnte. "Durch diese Fehlschläge geriet die UNO auch in weiten Teilen der
Öffentlichkeit in ein schlechtes Licht und sie erschien als unfähiger
Papiertiger" (Gareis/Varwick). Es wurde deutlich, dass die Friedensmissionen
neuen Typs eine völlig neue Konzeption erforderten. Zusammenfassend stellen
Gareis und Varwick fest: "Obwohl die Bilanz der VN-Friedenssicherung
keineswegs nur negativ ausfällt, war die Weltorganisation im Verlauf der
1990er Jahre in ihrem ureigenen Zuständigkeitsbereich in eine tiefe Krise
geraten."
[aus: Sven Gareis/Johannes
Varwick, Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen;
Bundeszentrale für politische Bildung Schriftenreihe Band 403, Bonn 2003, S.
131] |
Trotz intensiver Reformbemühungen
und innovativer Konzepte (besonders Boutros-Ghalis "Agenda
für den Frieden") führte diese Krise letztlich dazu, dass sich der Fokus bei
der Friedenssicherung von den Vereinten Nationen und ihrem Sicherheitsrat zu
regionalen Bündnissen und Staatengruppen verlagerte. Diese Tendenz wurde im
Kosovo-Krieg deutlich und hat sich im "Krieg gegen den Terror" der USA verstärkt.
Damit gerät nicht nur die Weltorganisation in Gefahr, sondern auch der
Grundgedanke der gemeinsamen Verantwortung aller Staaten für den Frieden, wie
die folgende Bilanz von Gareis und Varwick betont:
"Der Anspruch der Vereinten Nationen, das globale Friedenssicherungssystem mit
umfassender Zuständigkeit und legitimem Anspruch auf internationale Befolgung
seiner in der Charta verankerten Normen und Regeln zu bilden, wurde zusehends in
Frage gestellt. Der Vorwurf ... wurde laut, die Industrienationen würden die
Vereinten Nationen in selektiver Weise zur eigenen Interessendurchsetzung
instrumentalisieren. Den Vereinten Nationen droht damit die Gefahr der
Marginalisierung im Bereich der zentralen Aufgaben, zu deren Erfüllung sie 1945
gegründet wurden.
Mit dieser Entwicklung ist jedoch nicht nur die Sorge um den möglichen
Niedergang einer internationalen Organisation verbunden. Vielmehr geht es um die
grundsätzliche Problematik, ob die Fragen des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit auch künftig in der Verantwortung eines kollektiven
Friedenssicherungssystems verbleiben oder aber auf die Ebene der Staaten bzw.
regionaler Bündnissysteme rückübertragen werden sollen (...).
Bliebe diese Option de facto den Staaten auf Ad-hoc-Basis überlassen, würde
dieser Weg über kurz oder lang zur Abkehr von einer internationalen
Rechtsordnung führen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg unter vielen
Rückschlägen entwickelt hat, über deren Notwendigkeit jedoch bei aller
Fragilität ein weitgehender Konsens zwischen den Staaten besteht."
[aus: Sven Gareis/Johannes
Varwick, Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen;
Bundeszentrale für politische Bildung Schriftenreihe Band 403, Bonn 2003, S.
132]
[Autor: Ragnar Müller]
[Seitenanfang]
|